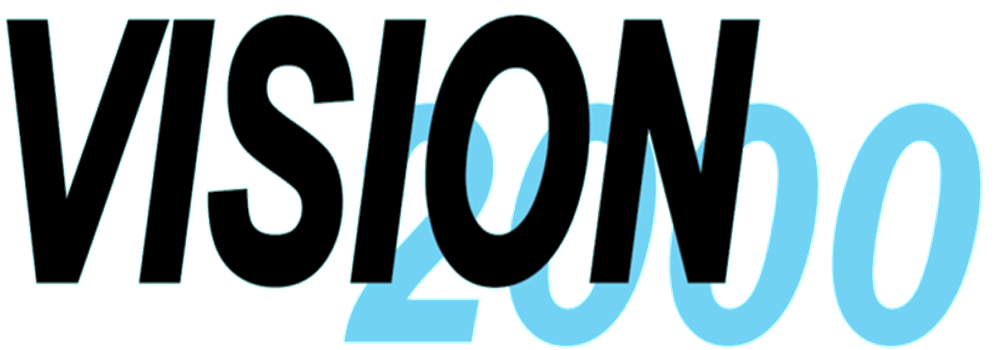Am 22. November 1924 wurde Maria Loley in Poysdorf im Weinviertel geboren und am 12. Februar wurde sie dort bestattet. Über sie, unsere mütterliche Freundin, die meinen Mann und mich fast zwei Jahrzehnte in tiefer Freundschaft begleitet hat, zu schreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Denn sie hatte, wie es Kardinal Schönborn in einer sehr persönlich gehaltenen Predigt beim Requien ausgedrückt hat, „das Evangelium in sich: Das kommt aus ihrem Herzen, ihrer Existenz, ihrem ganzen Leben – Evangelium pur!“
Am 22. November 1924 wurde Maria Loley in Poysdorf im Weinviertel geboren und am 12. Februar wurde sie dort bestattet. Über sie, unsere mütterliche Freundin, die meinen Mann und mich fast zwei Jahrzehnte in tiefer Freundschaft begleitet hat, zu schreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Denn sie hatte, wie es Kardinal Schönborn in einer sehr persönlich gehaltenen Predigt beim Requien ausgedrückt hat, „das Evangelium in sich: Das kommt aus ihrem Herzen, ihrer Existenz, ihrem ganzen Leben – Evangelium pur!“
Mein erster Eindruck im Jahr 1997 – sie lebte damals im Wiener Priesterseminar – war: Jedes Wort aus dem Mund dieser weisen Frau mit den gütigen Augen ist Gold wert. Ich muss sie unbedingt für unsere Zeitschrift portraitieren (siehe VISION 4/97). Seit damals sind wir in innigem Kontakt geblieben. Ich habe sie oft zu Vorträgen begleitet, ihre Worte wie ein Schwamm aufgesogen. Jahrelang haben mein Mann und ich mit ihr Sendungen für Radio Maria gestaltet, erst in Amstetten, dann im Studio in Wien. Und wieviele Artikel hat sie für VISION2000 geschrieben!
Was hat diese besondere Frau nicht alles erlebt! Sie ist knapp 20, als sie sich in ihrer Heimatstadt an der Betreuung von Flüchtlingen und Überlebenden des „Brünner Todesmarsches“ beteiligt. Dass sie sich dabei mit Ruhr, Typhus und Tuberkulose infiziert, hat sicher ihren Lebensweg mitbestimmt: Zeitlebens war ihre Gesundheit angeschlagen. Wäre sie gesund gewesen, wäre sie wohl ab 1949 beim den Karmeliterinnen geblieben, einem Orden, den sie aus gesundheitlichen Gründen wieder verlassen musste.
Maria hat uns erzählt: „Nach dem Scheitern bei den Versuchen, ins Kloster einzutreten, stand über Jahre hinweg die Frage im Raum, die ich dem Herrn gestellt habe: Was willst Du von mir, warum enthältst Du mir eine Gemeinschaft vor? Und Er hat mich erkennen lassen, dass mein Weg in der Welt ist, dass ich unter den Menschen meine Hingabe an Ihn leben soll. Als mir das bewusst wurde, hatte ich den Frieden, den ich in der Phase des Suchens teilweise verloren hatte, wieder.“
1949 beendet sie daraufhin ihre Ausbildung zur Fürsorgerin mit dem Staatsexamen. Und so wirkt sie dann sowohl als Fürsorgerin – etwa am Jugendamt in Mistelbach – wie auch immer wieder engagiert in der Flüchtlingsbetreuung: In den 50er Jahren in einem Flüchtlingslager in der Steiermark, in den 80er Jahren intensiv bei der Polenhilfe, wobei sie viele Hilfstransporte selbst begleitet. Damals adoptiert sie auch den 18-jährigen Thaddäus.
Sie hat mehrere Einrichtungen aufgebaut: den psychosozialen Dienst im Weinviertel, die Familienberatung und die Sozialstation in Poysdorf. Zu Beginn der 90-er Jahren sind es die Flüchtlinge aus Jugoslawien, um die sie sich bemüht. Dieses Engagement für Flüchtlinge hat noch im selben Jahr das Briefbombenattentat zur Folge. Sie überlebt es wohl nur deshalb, weil sie der Eingebung folgt, ihre Briefe diesmal gleich am Postamt zu öffnen und nicht wie sonst erst zu Hause. So ist auch sofort Hilfe zur Stelle.
Maria war stets von der Überzeugung getragen, dass Gott sie in keiner Situation im Stich lässt. Das bestätigt sich auch an jenem Tag, an dem sie stürzt, sich zwar nicht verletzt, aber zur Kontrolle ins Krankenhaus kommt. Dort treten starke Schmerzen im Bauch auf: „Die Untersuchung ergibt ein soeben geplatztes Aneurysma einer Arterie im Bauch. Ich hatte eine starke Blutung im Bauchbereich und musste sofort operiert werden. Mit dem Sturz hatte das nichts zu tun, doch der Arzt war froh, dass ich gerade im Krankenhaus war, als es passiert ist. Mit einem Schlag war mir klar: Ich lebe nur, weil Gott durch diesen sonderbaren Sturz massiv in mein Leben eingegriffen hatte. Nur wegen dieses Unfalls war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, nämlich im Krankenhaus in Wien. Mit großer Gewissheit und Sicherheit weiß ich, dass mein Leben in Seiner Hand liegt.“
Ihr unerschütterliches Vertrauen in Gottes Liebe hat es ihr immer wieder ermöglicht, sich trotz Schmerzen mit Freude den Mitmenschen zuzuwenden. Oder, wie Kardinal Schönborn es beim Requiem ausgedrückt hat: „Ihre gesundheitlichen Probleme, ihre Schmerzen hat sie durch die Zuwendung zu ihren Mitmenschen in den Hintergrund geschoben. Ihre ganz auf den anderen hingewendeten Blicke, von Herz zu Herz gehend, haben so viele Herzen und Seelen berührt. Bis zur letzten Sekunde war sie für andere da, hat versucht deren Not zu lindern.“ Sogar zwei Wochen vor ihrem Tod hat sie noch meinem Mann Kuverts mit Geld für einige ihrer Schützlinge mitgegeben.
Niemand, der sie gekannt hat, wird Marias liebevolle Blicke vergessen: Wie viel Zuneigung, Verständnis und Mitgefühl habe ich, haben wir, da erfahren dürfen! Marias Umgang mit den Menschen war für mich vorbildlich. Diese Beziehung hat sie einmal so beschrieben:
„Tief in mir hat sich das Bewusstsein verankert, dass es von größter Wichtigkeit ist, auf die Mitmenschen zuzugehen. Das beginnt ganz einfach damit, dass ich sie anschaue, einen offenen Blick auf sie werfe. Sobald ich merke, dass mich jemand mit einer gewissen Erwartung anblickt – ich merke das an der Art, wie er mich anschaut –, gehe ich auf ihn zu, grüße ihn, frage ihn, wie es ihm geht. Schon in meinem Gruß sollte die Achtung, die ich grundsätzlich vor meinen Mitmenschen habe, zum Ausdruck kommen. Der andere muss spüren: Ich komme ihm wertschätzend entgegen. Diese Achtung vor dem anderen muss ich in mir allerdings auch wirklich echt empfinden. Sie darf mir nicht nur als Denkmodell vor Augen stehen. Es geht darum, dass wir einander in Augenhöhe begegnen. Und das ist nur möglich, wenn ich meine Mitmenschen mit dem Herzen sehe, also im Herzen Achtung für ihn empfinde. Sie wird mir als Frucht einer lebenslangen Selbsterziehung zuteil.“
Haben wir das nicht alle immer wieder gespürt: Ich bin jetzt der besondere Mensch, für den sie ganz da ist, sich ganz auf mich, mein Wohl, meine Sorgen und Probleme konzentriert, mir uneingeschränkt zuhört? Ja, das Zuhören, das so vielen schwer zu fallen scheint, war für Maria wichtiger Bestanteil jeder Begegnung: „Wir müssen lernen, wirklich zuzuhören, auch auf die Gefühle des anderen zu achten. All meine Gedanken, all mein Empfinden müssen auf dieses Hören ausgerichtet sein. Das erfordert Geduld. Der andere muss reden dürfen, bis er von selbst aufhört. Sicher, wenn ich etwas nicht verstehe, macht es Sinn, eine Zwischenfrage zu stellen… Ich kann mich gut an ein Gespräch erinnern, in dem jemand sehr ausführlich und intensiv etwas erzählt hat. Aufmerksam habe ich ihm lange zugehört. Und plötzlich steht mein Gegenüber auf und sagt: ,Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben!’ Im Loswerden der Belastung ist ihm der helle Gedanke gekommen. Ein anderes Mal hat mir jemand, nachdem ich ihm lange zugehört hatte, gesagt: ,Jetzt habe ich wieder Mut. Jetzt gehe ich es wieder an. Danke für diese Stärkung’.“
Und sie ergänzte: „Eine solche Begegnung kann lebensrettend sein. Nicht nur einmal hat mir jemand gesagt: ,Wenn Sie damals nicht Zeit gehabt hätten – ich wäre nicht mehr am Leben!“ Viele Selbstmorde ließen sich allein dadurch verhindern, dass jemand bereit ist, sich belasten, sich betreffen zu lassen. Ich konnte das in meinem Leben nur deswegen immer wieder tun, weil ich wusste: Er, der Herr, trägt unsere Last. Ich kann mir ruhig aufladen lassen. Gott ist immer zur Stelle. Ich muss nur bereit sein, die Lasten der anderen mitzutragen. Fehlt mir diese Bereitschaft, so bin ich Mitschuld an dem, was mein Mitmensch erleidet, möglicherweise an seinem schlimmen Ende.“
Diese Kraft kam Maria aus dem Gebet zu: „Das Kernstück meiner Erfahrungen ist: Ich bete immer zum Heiligen Geist. Er umgibt, durchdringt und erfüllt mich. Ich weiß mich in Seiner Nähe. In jedem Gespräch ist Er da. Das weiß ich. Es ist der Heilige Geist, der die Führung hat. Er gibt mir Worte ein, bestimmt den Ton meiner Rede, gibt mir Geduld in schwierigen Situationen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, in dem mein Gegenüber unbedingt eine Antwort haben wollte, die ich ihm jedoch nicht zu geben vermochte. In einem stummen inneren Aufblick habe ich den Heiligen Geist angerufen. Nach einer kurzen Stille habe ich zu reden begonnen und dem anderen eine Antwort gesagt, die mir genauso neu war wie ihm. Es war eine Schlüsselerfahrung, die mir das Wirken des Heiligen Geistes greifbar gemacht hat.“
Wie oft haben wir in den letzten Jahren, als sie schon im Heim lebte, zuerst in Pitten, später in Laa n der Thaya, spät abends, wenn sie schon mit all ihren Schützlingen gesprochen hatte, noch miteinander telefoniert und unsere Gedanken ausgetauscht. Wie bereichernd für mich! Und nie hat sie vergessen, sich liebevoll und interessiert nach unseren Kindern und Enkeln zu erkundigen. Wenn ich jetzt in den Texten aus mitgeschnittenen Gesprächen – sie waren für ein Buch gedacht – lese, so bin ich aufs Neue dankbar für ihre wegweisenden Worte.
So meinte sie z.B. zum Thema Kirche: „Die Kirche ist mir schon als Kind begegnet: in der Erstkommunion. Da wurde das Fundament meines Lebens gelegt: Jesus in mir – und ich in Jesus. Das habe ich schon als Kind begriffen. Dieses Geheimnis hat mein Leben unsichtbar geleitet – über alle Wechselfälle hinweg. Während des Krieges habe ich dann die Kirche in besonderer Weise als Gemeinschaft erlebt. Das hat mich sehr geprägt. Diese Gemeinschaft stand damals unter besonderen Gefahren, denn jeder Gottesdienst stand unter einem gewissen Risiko. Wir hatten einen äußerst mutigen Kaplan. Noch während des Krieges hat er es gewagt, Abendmessen mit den Jugendlichen zu halten. Wir sind um den Altar gestanden. Dass er so viel gewagt hat, gab uns jungen Leuten wiederum Mut. Es hat uns das Gefühl von Stärke vermittelt: Wir sind keine Nazi, wir sind Christen!
Und dann die vielen Stunden der Nachtanbetung. Ich habe viele Stunden in der Nähe des eucharistischen Herrn gelebt. Aber das Kernstück der Stunden war die Heilige Schrift. Dem Kaplan verdanke ich meine besondere Beziehung zur Geheimen Offenbarung. Diesen Zugang hat er mir eröffnet.“
Trotz der Gefahr macht die Jugendgruppe mit dem Kaplan – in Zivil – 1943 eine Wallfahrt nach Mariazell. Maria erzählt: „Mariazell – das war für uns die erste Gelegenheit, aus dem Dorf heraus- und in die große Welt zu kommen, eine Sensation! Wohnen in einer Herberge. Alles war aufregend. Und dann das erste Mal in der Basilika: atemberaubend… Diese Wallfahrt hat sehr dazu beigetragen, dass unsere Gruppe wie eine Familie erlebt wurde. Das hat uns dann auch sehr geholfen, gemeinsam das Jahr 1945 durchzustehen, den Einmarsch der Russen. Ohne diese tragende Gemeinschaft wäre jede von uns viel, viel ärmer gewesen. Dazu muss man wissen, wie die Russen vorgegangen sind, wenn sie einen Ort besetzten: Da war keine Frau vor ihnen sicher. Wer nicht vergewaltigt wurde, hatte Glück gehabt.
Der Keller meiner Familie war bis zum Rand voller Leute, die sich vor den Russen versteckten. Der Kaplan hat sich im Talar vor die Türe gestellt. Er hatte begriffen, dass er – wenn er als Priester zu erkennen war – von den Russen respektiert würde. Vor Popen hatten sie Respekt. Wo der Pfarrer und der Kaplan auftraten, war also Sicherheit. So hat der Kaplan alle Leute in unserem Keller – und viele andere Frauen auch – gerettet. So eine Lebensgemeinschaft war völlig vom Glauben getragen. Das war eine ganz tiefe persönliche Erfahrung von Kirche. Kirche ist gelebtes Evangelium. Sie ist eine geistige Wirklichkeit.“
Trotz vieler Enttäuschungen, die sie auch erlebt hat, konnte sie in hohem Alter sagen: „Seit meiner Jugendzeit liebe ich die Kirche, weil sie mir Jesus schenkt, weil sie Ihn mir offenbart. Jesus und die Kirche – das ist für mich eine untrennbare Einheit. Er hat sie uns ja geschenkt. Wenn Leute sagen: Jesus ja – Kirche nein, dann ist das ein Unsinn. Das kann nur auf Unwissen beruhen. Meint man da etwa die Organisation? Äußere Strukturen? Das gehört ja überall, wo Leben ist, dazu. Ich finde es richtig deprimierend, auf welcher Ebene sich heute solche Debatten abspielen. Das können doch nur Menschen sein, die nicht in der Heiligen Schrift lesen, die sich nicht für das Wort Gottes geöffnet haben.
Dass in menschlichen Strukturen alle Möglichkeiten für Fehler und Versagen sind, kann jeder an sich selbst beobachten. Dazu genügt ein ehrlicher Blick auf die eigene Situation. Sich von Fehlern in der Kirche zu distanzieren und sich über Versagen zu verwundern, das ist einfach scheinheilig. Genaugenommen sind das eben unsere Fehler. Oft denke ich mir: Was tun wir nicht alles Jesus mit unserer stupiden Kirchenkritik an! Meist ist sie mir zu dumm, um mich mit ihr zu befassen. Das sage ich nicht aus Hochmut, denn ich würde mich keinem, der solche Kritik äußert, verschließen. Schließlich: Was sage nicht auch ich alles… Wenn ich daran denke, wie Jesus zeitlebens mit den Sündern umgegangen ist, sage ich mir: Welche Gnade, als Sünder mit Jesus Gemeinschaft haben zu dürfen. In dieser Gemeinschaft kann Er etwas wirken.“
Im Zuge ihrer Übersiedlung 1995 nach Wien ins Priesterseminar erlebte Maria die Kirche ebenfalls von ihrer schönen Seite: „Nach dem Bombenattentat hat Kardinal Schönborn diese Übersiedlung forciert, um mich vor weiteren möglichen Attacken zu schützen. Mit den Seminaristen war es Liebe auf den ersten Blick. Sie haben mich von Anfang an gemocht. Nach vielen Jahren der Einsamkeit erstmals wieder die Erfahrung von Kirche, Ich war zutiefst bewegt: Aus dem ursprünglich vorgesehenen Schutz, der mir gewährt wurde, hat sich eine mütterliche Beziehung zu den Seminaristen entwickelt. Sie sind immer häufiger mit ihren persönlichen Problemen zu mir gekommen. Und ich war selig, weil ich mich wieder mitten in der Kirche befunden habe. Die Kirche brauchte mich als Mutter. Im Schenken von Mutterliebe habe ich Kirche erlebt. Ich verdanke Kardinal Schönborn daher sehr viel: Er hat nicht nur mein in der Jugend abgelegtes Gelübde in die Kirche geführt, sondern er hat mir eine Bejahung eröffnet, die ich in dieser Form noch nie erlebt hatte.“
Beim Requiem hat sich der Kardinal ebenfalls an diese Zeit erinnert: „Im Priesterseminar war sie Jahre hindurch für viele Seminaristen. Klagemauer, Beichtmutter, Trösterin und energische Helferin in Krisen.“
In dieser Zeit entsteht auch der Verein „Bewegung Mitmensch – Hilfe für Menschen in Not“. Vielen Menschen werden Maria und ihre Mitarbeiter in den folgenden Jahren in den verschiedensten Nöten und Sorgen beistehen. Und dabei hat Maria zwischen 1997 und 2003 mit enormen Gesundheitsproblemen zu kämpfen: Herzinfarkt, Schlaganfall, Operationen. Kaum genesen, stürzt sie sich jedoch stets wieder ins Getümmel: Nimmt sich der Notleidenden an, hält Vorträge, führt stundenlange Telefonate…
Gott sei Dank wird ihr Einsatz doch auch immer wieder honoriert: 1994 erhält sie den Preis des UNO-Hochkommissariat für Flüchtlingshilfe. Dessen 100.000 Schilling wandern sofort in die Hilfe für Notleidende. Es folgen weitere Auszeichnungen: 1998 Goldenes Verdienstzeichen der Republik, 2004 der Stephanusorden in Gold, 2005 das Silberne Ehrenzeichen der Republik, 2007 Liese-Prokop-Frauenpreis und einige andere.
Erwähnen möchte ich nur noch den 2008 verliehenen Preis „Gustl 58 – Initiative für Herzensbildung“: Preis in Form einer Wärmflasche gestaltet vom Künstler Erwin Wurm: „weil der, der mit dem Herzen offen für Menschen ist, Wärme gibt.“
Keine Frage, Maria hat menschliche Wärme ausgestrahlt. Aber sie hat auch immer wieder versucht, ohne Rücksicht auf Verluste falsche Vorstellungen zurechtzurücken. Etwa als sie feststellte: „Der Böse – ihn gibt es kaum in den Gedanken der Menschen. Und das ist äußerst bedenklich. Denn das Böse entsteht ja irgendwo. W≠enn dessen Verursacher nicht gesehen wird, dann wird eben das Böse weiterhin zunehmen… Genau das ist ein Werk des Teufels. Dadurch, dass seine Existenz nicht als Realität gesehen wird, konnte er die Menschen einschläfern. Die Vernebelung, das Verwirren der Gedanken, gehört ja zu seiner Taktik. Und dieses Spiel ist ihm heute geglückt. Die Theologen sind ihm darauf hereingefallen. Der Apostel Petrus schreibt ja klar und eindeutig: ,Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens!’ Die Wachsamkeit ist wichtig. Auch Jesus sagt: ,Wachet und betet!’
Zur Wachsamkeit gehört auch das Gebet. Es geht um die Ausrichtung auf den Herrn. Daher bete ich viel. Und dadurch werde ich reich beschenkt. Der Herr schenkt mir Weisheit, Erkenntnis, Urteilsfähigkeit. Und auf diese Weise werde ich schwer angreifbar durch den Bösen: Es ist viel Böses um uns, im Gehaben, im Verhalten der Menschen, in den Botschaften, die auf uns eindringen, in den Bildern, die uns vorgesetzt werden. Wir sind all dem ausgesetzt und daher immer auch gefährdet. Daher haben wir diese Bitte ,Erlöse uns von dem Bösen’ so notwendig – und: Erlöse die vielen Menschen, die vom Bösen gefangen sind! Und führe sie zur Freude…“
Und Maria fährt fort: „Im Laufe der Zeit wurde mir bewusst: Jesus brennt förmlich darauf, uns Seine Freude zu schenken. Und daher ist es naheliegend, Ihn um diese Freude zu bitten. Sobald wir Ihn nämlich darum bitten, öffnen wir unser Inneres und Jesu Freude kann in uns einziehen. Daher ist es mir, wann immer ich bedrückt bin, zur selbstverständlichen Gewohnheit geworden, Jesus zu bitten: ,Herr, gib mir Deine Freude!’ Und ich kann bezeugen: Er gibt diese Freude immer – und zwar auf der Stelle. In solchen Situationen habe ich den Eindruck, Jesus wartet nur darauf, dass Er mich mit Seiner Freude beschenken kann.“
Vor dem Tod hat sich Maria nicht gefürchtet, ihn gegen Ende ihres Lebens eher herbeigesehnt. So sagte sie schon vor Jahren: „Eine Schriftstelle aus den Abschiedsreden kommt mir häufig ins Gedächtnis. Jesus sagt da, dass Er zum Vater geht, um uns dort eine Wohnung zu bereiten. Und dann ,komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.’ Diese Verheißung bereitet mir eine sehr große Freude – dort zu sein, wo Jesus ist! Von diesem Wort geht die Gewissheit einer unermesslichen Freude aus. Sie strahlt zusammen mit der weiteren Gewissheit, nicht im Stich gelassen zu sein, in mein diesseitiges Leben herein. Damit wird dieses Heimgehen eine Erfahrung des alltäglichen Lebens. Ich gehe ständig auf den Herrn zu.“
Als Trost für uns, die wir jetzt ohne Maria auskommen müssen, möchte ich das abschließende Wort des Kardinals bei seiner Predigt beim Requiem zitieren: „Maria hat jetzt im Licht des Herrn für uns alle ein ganz großes Herz. Das Konzil sagt: Weil die Verstorbenen jetzt mit Christus inniger verbunden sind, sind sie uns näher als je zuvor. Das können wir getrost als Wirklichkeit annehmen.“
Nach der Sendung, die ich als Nachruf auf Maria für Radio Maria gestaltet habe, bin ich in die Studiokapelle gegangen und habe für sie ein Schriftwort aus dem dort aufgestellten Körbchen gezogen. Wie treffend! Es lautet: „Der Herr, Dein Lehrer, wird sich nicht mehr verbergen. Deine Augen werden Deinen Lehrer sehen.“ (Jes 30,20)
 Am 22. November 1924 wurde Maria Loley in Poysdorf im Weinviertel geboren und am 12. Februar wurde sie dort bestattet. Über sie, unsere mütterliche Freundin, die meinen Mann und mich fast zwei Jahrzehnte in tiefer Freundschaft begleitet hat, zu schreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Denn sie hatte, wie es Kardinal Schönborn in einer sehr persönlich gehaltenen Predigt beim Requien ausgedrückt hat, „das Evangelium in sich: Das kommt aus ihrem Herzen, ihrer Existenz, ihrem ganzen Leben – Evangelium pur!“
Am 22. November 1924 wurde Maria Loley in Poysdorf im Weinviertel geboren und am 12. Februar wurde sie dort bestattet. Über sie, unsere mütterliche Freundin, die meinen Mann und mich fast zwei Jahrzehnte in tiefer Freundschaft begleitet hat, zu schreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Denn sie hatte, wie es Kardinal Schönborn in einer sehr persönlich gehaltenen Predigt beim Requien ausgedrückt hat, „das Evangelium in sich: Das kommt aus ihrem Herzen, ihrer Existenz, ihrem ganzen Leben – Evangelium pur!“