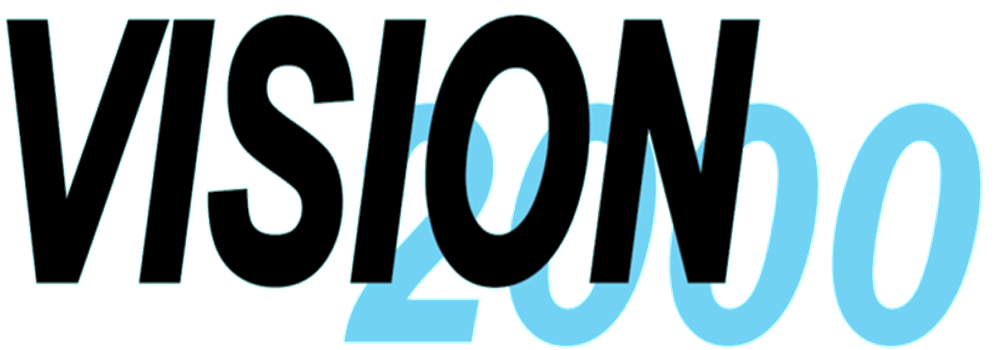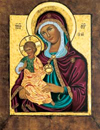Was fällt Menschen auf, die unsere Art zu leben erstmals (oder nach längerer Abwesenheit) beobachten? Wir haben (auch durchaus kritische) Antworten auf diese Frage zusammengetragen. Mancher mag nun denken: Wo bleibt da der positive Zugang der Zeitschrift? Dazu wäre folgendes zu sagen: Nicht um genüßlich im Negativen zu wühlen, bringen wir diese wohlwollenden Kritiken, sondern um unseren Blick für so manche fragwürdige Selbstverständlichkeit zu schärfen.
Tatjana Goritschewa
Meine Erfahrung im Westen ist die: Da kann man jahrelang mit einem Menschen bekannt sein, man kann im Umgang mit ihm lieb und freundlich sein, aber man bringt es nicht fertig, ihn zu erkennen! Weil er das nicht will (es vielleicht auch nicht kann) und du auch nicht. Im Westen ist alles allzu gut organisiert und zu perfekt gestaltet, als daß da noch ein Spalt bliebe für die Person. Es gibt ganz wenige, die fähig sind, einfach zu leben.
Deshalb ist im westlichen Leben das Schecklichste die Einsamkeit. Allein zu sein ist eine echte Tragödie ... Auch deshalb ist die Arbeitslosigkeit so schrecklich. Es ist nicht nur das fehlende Geld: Der Mensch ist aus der Gesellschaft herausgefallen. Er ist allein. Und Bindungen nicht formeller Art, die bei uns in Rußland so entwickelt sind, gibt es hier im Westen fast nicht mehr.
Wenn ich vor westlichen Christen spreche, bin ich oft gezwungen, "lebhaft", expressiv und stark zu sein. Weil in Europa nicht unsere Leidenschaft und Energie herrschen, sondern Tod und Kraftlosigkeit. Hier muß man, um ein Gespräch über den Geist in Gang zu setzen, erst einmal Interesse hervorrufen, vom Schlaf aufwecken, "das Wohlbefinden sprengen".
Natürlich kenne ich den Westen fast nicht, und so Gott will, habe ich unrecht. Aber mir scheint, daß es dort die Versuchung eines allzu wohlbehaltenen, "rosaroten" Christentums gibt. Wenn man das Böse auch anerkennt, so nur als ein naturgegebenes oder soziales Böses, d.h. als Böses ohne indviduelle oder charakteristische Eigenschaften und nicht als Böses, das sich in konkreten Personen angesiedelt hat. Und doch hat Christus Dämonen aus Menschen ausgetrieben.
Die Zeit liegt lange hinter mir, als ich an einer theologischen Hochschule in Deutschland studierte und die Erfahrung machen mußte, daß da mehr über Gott gelacht wurde als daß man, von Seiner Größe und Herrlichkeit ergriffen, seine Wirklichkeit verkündet hätte. Ich bin vor einem solchen theologischen Studienbetrieb geflüchtet. Eine schreckliche Erinnerung habe ich an eine Versammlung, bei der die Teilnehmer überwiegend katholische Priester waren. Als ich von der Wichtigkeit des Kreuzes sprach ("Nimm dein Kreuz auf dich, und folge mir nach"), stürzten sie sich auf mich wie auf eine Verbrecherin: "Das ist doch Masochismus." Und doch waren es keine dummen Leute, die das gesagt hatten. Im Gegenteil, an sich waren diese kirchlich bestallten Ausleger des Wortes Gottes sympathische, gebildete Menschen, die ihren Nächsten Gutes wünschten. Nur beten konnten sie überhaupt nicht. Die meisten sagten, daß "die Periode des Gebets" bei ihnen schon weit zurückliege.
Während eines äußerst kurzen "Gottesdienstes", der diese Bezeichnung kaum verdiente, erhellte sich das Gesicht nur bei einer alten Frau "aus dem Volk", die sich dort zufällig eingefunden hatte. Die übrigen aber saßen wie vorher schon mit kalten und gleichmütigen Mienen da, als ob da irgendein Tagungsgeschehen abliefe ... Und dennoch gibt es das gläubige, einfache Volk, in Deutschland wie in Frankreich. Das heißt, es gibt den Glauben an die Notwendigkeit des Opfers und das Gefühl des Sieges über die Welt, über die Sünde ...
Hier im Westen habe ich auch Menschen getroffen, die die Kühnheit der Liebe, die Unbändigkeit der Freude und die Fülle der Kirchlichkeit in sich tragen.
In den ersten Jahren meiner Emigration, als ich oft Vorträge hielt vor Tausenden westlicher junger Menschen, freute ich mich: Wie klug sie schon sind. Sie haben sogar in der materialistischen westlichen Welt zu Gott gefunden. Dann begann ich zu bemerken, daß es durchaus nicht Gott ist, der viele von ihnen verbindet. Die meisten treten in diese christlichen Jugendbewegungen ein, weil es nichts anderes gibt, dem sie sich anschließen könnten. Sie suchen Freundschaften, freundschaftliche Beziehungen, ihren Kreis, die Mädchen halten Ausschau nach einem Bräutigam.
Nach 30 Jahren, wenn sie sich dann eine Familie, ein Haus, zwei Kinder angeschafft haben, verläßt die Mehrzahl der jungen Leute diese Bewegungen. Damit ist das Prinzip klar: Solange du jung bist, kannst du die ganze weite Welt durchreisen, kannst dich unter deinen Altersgenossen herumdrücken, von einer allgemeinen Einheit, von Frieden und Brüderlichkeit träumen, aber dann fordert das ernsthafte, bürgerliche Leben seine Rechte. Und dennoch sucht das Herz eines jeden Menschen Gott, und man muß sich freuen, daß es Orte wie Taizé gibt, wo diese jungen Leute hinfahren können.
Ich sehe hier die Menschen, die einfach nichts brauchen und keine innere Spannung haben. Man wartet nicht so auf das Wort der Wahrheit und Rettung. Ich spreche nicht über alle, sondern über das, was ich im Durchschnitt sehe. Oft weiß ich selbst nicht, über welche Dinge ich mit den Menschen sprechen könnte. Es ist schwer, die Achillesehne zu finden und einen Platz in der Seele des Menschen zu entdecken, wo man erkennen kann, daß er leidet, und was ihm fehlt. Das Leiden ist gut und tief verborgen. Die Lage der Kirche hier ist viel schwieriger als die Lage der Kirche in Rußland, die von außen her unter Druck steht, aber die innere Freiheit besitzt. Hier hat die Kirche zwar die äußere Freiheit, aber innen ist sie sehr schüchtern. Sie hat keine Macht. Ich sehe hier, daß viele Priester zu schüchtern sind, um über Gott zu sprechen ...
Auszüge aus "Unaufhörlich sucht der Mensch das Glück", Herder, Freiburg 1989
Alex Okot
Natürlich hängen meine Eindrücke von Europa stark von den verschiedenen Menschen ab, denen ich in Italien, Österreich und Deutschland begegnet bin. Aber vielleicht ist es interessant, über meine ersten europäischen Eindrücke in Rom zu sprechen, als ich gerade aus meiner Heimat Uganda angekommen war. Im Gespräch mit Studenten fiel mir auf, daß sie sehr freie Menschen sind. Sie sprechen mit Dir in einer sehr offenen Weise. Man könnte fast glauben, ihnen schon vorher begegnet zu sein. Es fallen alle Formalitäten weg. Oft weiß man gar nicht, wie sie heißen.
Auf der anderen Seite passierte es mir oft, daß ich das Verhalten von Menschen mißdeutete: Jemand war sehr freundlich zu mir, aber es stellte sich nur allzubald heraus, daß er an mir gar kein wirkliches, sondern nur ein "geschäftliches" oder sonstiges Interesse gehabt hatte. Also eine gewisse Offenheit - aber vordergründig und interessenbezogen. Auch, was das Familienleben anbelangt, erlebte ich Überraschungen. Bei uns ist der Vater sehr oft abwesend. Wir haben wenig Beziehung zu ihm. Er arbeitet, und seine Freizeit verbringt er außerhalb der Familie. Hier sind die Väter - jedenfalls dort, wo die Familien funktionieren - viel stärker integriert.
Ja, und dann erlebt man als dunkelhäutiger Mensch doch einige Überraschungen im Umgang mit den Menschen hier, besonders in Österreich und Deutschland: Da gibt es Leute, die erklären mir einfach, daß sie mit mir nicht reden wollen, weil ich ein Schwarzer bin. Das kann mitten in Unterhaltungen passieren, wie etwa kürzlich in einer größeren Runde im Kaffeehaus. Aber auch auf offener Straße bin ich schon angepöbelt worden.
Mir kommt vor, daß sich die Jugend hier in ihren Vorstellungen und in ihrem Lebensstil viel stärker von der Generation ihrer Eltern abzusetzen versucht, als dies bei uns der Fall ist. Hier scheint es mir keine allgemein verbindlichen Werte zu geben, die den Menschen in Problemsituationen anzeigen, wie sie sich verhalten sollten. Und daher gibt es für die heranwachsenden jungen Menschen keinen Rahmen, der ihnen Halt gibt.
Und das führt mich zu einer weiteren Beobachtung: Eure Jugend hier tut sich schwer mit Autorität. Wir haben Respekt vor den alten Menschen, vor ihnen ganz besonders, aber auch vor jenen, die älter sind als wir, sei es ein Bruder oder eine Schwester. Daher spielen die älteren auch in der Erziehung bei uns eine viel größere Rolle als hier. Hier in Europa kommt dem Bildungssystem eine große Bedeutung zu. In Uganda wäre es etwa undenkbar, die Sexualerziehung in die Schule zu verlegen. Ja - vielleicht für rein biologische Aspekte. Bei uns werden insbesondere die Madchen stets in der häuslichen Umgebung von den erwachsenen Frauen in die Fragen der Sexualität eingeführt und zwar in den Küchen, in denen eindeutig die Frauen das Sagen haben.
Und das bringt mich zu einer weiteren Beobachtung: Der freie Umgang, den Burschen und Mädchen miteinander haben. Es war wie im Film, sie bis spät in die Nacht miteinander herumziehen zu sehen, sie miteinander leben zu sehen. Bei uns spielen nur die kleinen Kinder alle miteinander. Ab einem bestimmten Alter verbringen Burschen und Mädchen im allgemeinen ihre freie Zeit nicht zusammen. Man trifft sich vielmehr zu besonderen Anlässen, bei Festen, bei traditionellen Tänzen. Ich will die hiesige Form keineswegs verurteilen. Wahrscheinlich hätte ich mir auch gewünscht, einen solchen Umgang zu haben.
Kinder wachsen hier ganz anders auf als bei uns. Sie sind dauernd in Kontakt mit Erwachsenen, werden von ihnen überwacht oder angeleitet. Man sagt ihnen: Tu dies, tu jenes. Man zerbricht sich dauernd über die Kinder den Kopf. Bei uns haben Kinder viel mehr Freiraum, sind viel mehr unter sich, spielen irgendwo ohne Beaufsichtung durch Erwachsene. Das heißt nicht, daß sie in jeder Beziehung alles tun dürfen. Im Gegenteil im Umgang mit den Menschen in der Gemeinschaft gibt es sehr strenge Regeln, deren Einhaltung verlangt wird. Aber in der Gestaltung des Alltags ist man frei. Das fördert die Kreativität, die Phantasie. Das Aufziehen von Kindern ist hier sehr problematisiert.
Mir fällt auch auf, daß ihr die Kinder hier allzu sehr verwöhnt. Sie bekommen dauernd etwas. Das können Sachen sein. Es kann sich aber auch um Unterhaltung handeln - etwa in Form von sehr häufigem Fernsehen. Darf es einen dann wundern, wenn sie dauernd etwas haben wollen - und sich dann gar nicht mehr so recht darüber freuen. Sie meinen ja, darauf Anspruch zu haben.
Alex Okot studiert Soziologie in Rom.
Tony Festin und Joy Quindoza
Unsere Begegnung mit Eurer Jugend und Euren Kindern schuf eine lebendige und freudige Atmosphäre. Wir bemerkten ihre Wißbegierde, nicht nur uns selbst besser kennenzulernen, sondern auch unsere Lebensart ... Als wir die Jugend näher kennengelernt hatten, fühlten wir, daß sie nach neuen Strukturen und nach neuem Lebenssinn sucht und dabei auf Hilfe und Führung in ihren Gemeinden hofft.
Unsere Besuche in den verschiedenen Schulen ließen uns erkennen, daß Eure Schüler und Studenten in der glücklichen Lage sind, kostenlose Schulbildung zu haben. Andererseits haben wir festgestellt, daß trotz dieser verbesserten Möglichkeiten wie Gratisschulbücher, Freifahrten, vielleicht auch kostenlose Mahlzeiten, die Schüler diese Privilegien nicht schätzen. Es herrscht der Geist, daß der Staat für alles verantwortlich ist, weil ja die Eltern Steuern zahlen.
Wir erkennen, daß Eure alten und kranken Leute, die an den Rand ihres Lebensgebäudes gedrängt werden, mehr Zuwendung brauchen. Wir waren wegen ihrer Einsamkeit und Leere zu Tränen gerührt. Sie fühlen diese Einsamkeit umso mehr in ihrer Krankheit und Abhängigkeit und auch deshalb, weil sie von ihren Geliebten getrennt sind.
Euer Lebensstandard ist tatsächlich hoch, sodaß wir niemals auf die Idee kamen, daß es auch Leute gibt, die kein Zuhause haben, und die sich als Außenseiter der Gesellschaft fühlen.
Die Arbeiter in den Fabriken und die Angestellten in den verschiedenen Ämtern und Firmen stehen unter Zeitdruck, weil Zeit gleichgesetzt wird mit Geld, und Lebensqualität basiert auf Geld. Dasselbe gilt für die Marktleute. Dieses Arbeitssystem vermindert die Zeit, die man mit den Familien, mit den Nachbarn, mit den Mitarbeitern, mit sich selbst und mit Gott verbringen könnte. Daraus ergibt sich, daß Ihr individualistisch werdet und die Folgen, die sich daraus für die Gesellschaft ergeben, nicht erkennt.
In den alten Kirchen hatten wir das Gefühl, in einem Museum zu sein. Der Triumphalismus herrscht hier vor, der im Gegensatz zu dem steht, was wir anstreben: eine Kirche der Armen zu werden. In Melk berührte es uns sehr schmerzlich, daß wir die Kirche nicht betreten und beten durften, weil wir keine Touristen waren. Wir erkannten jedoch auch, daß diese Art von Kirchen ein Teil Eures Erbes ist und daß wir Euch nicht beurteilen können, wenn wir nicht Eure lange Geschichte kennen.
Euer Lebensstandard ist hoch, Ihr habt ein höheres Einkommen, aber Ihr müßt auch mehr ausgeben, um diesen Standard aufrechtzuerhalten. Und Ihr müßt schwer für all das arbeiten und tauscht dafür Werte wie Beziehungen zueinander, Kommunikation und Zeit für andere ein. Wir glauben immer noch, daß Ihr diese Art von System, diesen Lebensstil nicht wollt. Und wir merkten auch, daß Ihr Euch bemüht, einen besseren Weg zu finden, einen Weg, der Eure Gesellschaft menschlicher macht.
Während unseres Mitlebens mit Euch haben wir sehr viel guten Willen in Euch entdeckt, insofern als Ihr aus Euch herausgegangen seid, um unseren Aufenthalt sinnvoll und fruchtbringend zu machen. Dadurch haben wir gesehen, daß wir wirklich etwas gemeinsam haben, was wir immer hochschätzen und bewahren wollen: Unsere Gastfreundschaft und Wärme zueinander.
Aus dem Abschlußbericht des Besuchs einer Gruppe von Philippinen, die als Verteter der Diözese Infanta dem Vikariat Süd der Erzdiözese Wien, mit dem sie eine Partnerschaft verbindet, einen mehrwöchigen Besuch abgestattet haben.
Alexander Solschenizyn
Als die modernen westlichen Staaten gegründet worden sind, wurde das folgende Prinzip verkündet: Die Regierungen sollten im Dienst der Menschen stehen, und die Menschen sollten frei sein, um ihr Glück zu verfolgen. Nun hat der technische und gesellschaftliche Fortschritt - jedenfalls in den letzten Jahrzehnten - die Verwirklichung dieses Zieles ermöglicht. Das Ergebnis ist der Wohlfahrtsstaat. Jedem Bürger steht heute so viel an Freiheit und an materiellen Gütern zu, um ihm zumindest theoretisch ein glückliches Leben - zumindest in dem moralisch eher minderwertigen Sinn, den dieser Begriff in den letzten Jahrzehnten angenommen hat - zu ermöglichen.
In dieser Entwicklung wurde jedoch ein psychologisches Detail übersehen. Der anhaltende Wunsch, immer mehr und mehr Güter zu besitzen, ein besseres Leben zu führen und der Kampf, diese Ziele zu erreichen, prägen den Gesichtern vieler hier im Westen einen Ausdruck von Sorge, ja von Depression auf - obwohl man ja gewohnheitsmäßig solche Gefühle zu unterdrücken versucht.
Die Menschen im Westen haben ein besonderes Geschick im Umgang, in der Interpretation und in der Manipulation der Gesetze entwickelt, obwohl diese für den Normalverbraucher so kompliziert sind, daß er zu ihrem Verständnis eines Experten bedarf. Jeder Konflikt wird nach dem Buchstaben des Gesetzes entschieden, und dies gilt als der Weisheit letzter Schluß. Ist jemand vom rechtlichen Standpunkt aus im Recht, so genügt das. Freiwillige Selbstbeschränkung erlebt man fast nie. Jeder agiert an der Grenze der vom Gesetz bezeichneten Möglichkeiten.
Einer zerstörerischen und verantwortungslosen Freiheit wurde grenzenlos Raum gewährt. Die Gesellschaft scheint wenig Abwehrkräfte gegen die abgrundtiefe Dekadenz des Menschen, etwa gegen den Freiheitsmißbrauch zur moralischen Vergewaltigung der Jugend, gegen pornographische Filme, Verbrechen und Horror zu haben. Das wird als Teil der Freiheit angesehen. Sie werde theoretisch vom Recht der Jugend, sich all das nicht anzuschauen oder es abzulehnen, ausgeglichen. Ein rein rechtlich organisiertes Leben zeigt damit seine Unfähigkeit, sich gegen die Unterwanderung durch das Böse zu verteidigen.
Ohne jede Zensur werden im Westen modische Denkrichtungen und Ideen sorgfältig von den nicht modischen getrennt. Es ist zwar nichts verboten, aber das, was nicht "in" ist, wird kaum jemals seinen Weg in Zeitschriften und Bücher finden oder an Hochschulen unterrichtet werden.
Dem Gesetze nach sind Eure Forscher frei, aber ihr Tun wird bedingt von den Moden des Tages. Nein, es gibt nicht die offene Gewaltanwendung wie im Osten. Aber die Auswahl, die von Moden und von der Notwendigkeit, der allgemeinen Norm zu entsprechen, diktiert wird, verhindert, daß selbständig denkende Menschen sich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen. Es gibt hier eine gefährliche Tendenz zur Herdenbildung ...
Die westliche Lebensart verliert zunehmend ihre Vorbildfunktion. Es gibt tiefsinnige Warnungen, die die Geschichte einer bedrohten oder zugrundegehenden Gesellschaft gibt. Solche sind zum Beispiel die Dekadenz der Kunst und das Fehlen großer Staatsmänner.
Wir stehen vor einer Katastrophe, die schon lange Zeit unterwegs ist. Ich spreche vom Elend, das ein religionsloses und den Geist verleugnendes humanistisches Bewußtsein darstellt. Für diese Sicht ist der Mensch der einzige Prüfstein. Er richtet und bewertet alles, er, der unvollkommene Mensch, der niemals frei von Stolz, Eigensucht, Neid, Eitelkeit und einem Dutzend anderer Untugenden ist. Wir sind jetzt mit Folgen jener Fehler konfrontiert, die wir zu Beginn unserer Reise gemacht haben. Von der Renaissance bis heute haben wir zwar unsere Erfahrungen enorm erweitert, aber die Vorstellung von einem Höchsten Wesen, das unsere Leidenschaften und unsere Unverantwortlichkeit in Grenzen zu halten pflegte, verloren. Wir haben unsere Hoffnung allzu stark auf politische und gesellschaftliche Reformen gesetzt, um nun zu entdecken, daß wir unser wertvollstes Gut verloren haben: das spirituelle Leben. Im Osten wurde dies durch das Handeln und die Manipulation der herrschenden Partei bewerkstelligt. Im Westen sind es die wirtschaftlichen Interessen, die den Geist ersticken. Das ist der Kern der Krise.
Auszug aus der Rede von Alexander Solschenizyn anläßlich der Verleihung des Ehrendoktorates an den russischen Autor durch die Harvard Universität im Juni 1978, zitiert in "Harvard University Gazette" vom 8.6.1978
Heinz Gattringer
Wohl einer der deutlichsten Eindrücke bei unserer Rückkehr aus Zimbabwe war die Überfülle des Angebots in den Geschäften. Wir haben uns richtig erschlagen gefühlt. Wir haben uns damals vor zwei Jahren immer wieder gefragt: Ist denn das alles wirklich notwendig?
Wir hatten ja erlebt, wie die Leute in Zimbabwe in die Städte einkaufen gefahren sind. Eingepfercht in Busse brachten sie von zuhause ihre Produkte auf den Markt, um sie zu verkaufen. Und was sie dann dafür erworben haben, war eben das Lebensnotwendige, nichts Besonderes. Aber die Leute waren dabei - ohne daß ich das jetzt übertrieben idealisieren möchte - mit dem wenigen glücklich, zufrieden. Wenn man hingegen hier Leuten beim Einkaufen zuschaut!
Etwas anderes ist auch zu erwähnen: Entwicklungshelfer leben in der Dritten Welt meist in einer Umgebung, die sie sehr offen empfängt. Da erlebt man eben fast einen Schock, wenn man in die weitaus kühlere, industrialisierte Gesellschaft zurückkommt. In Zimbabwe steht der Mensch im Mittelpunkt, und die menschlichen Beziehungen gehen vor den funktionsnotwendigen Abläufen. Bevor man eine technische Vereinbarung trifft, ist es wichtig eine persönliche Beziehung anzuknüpfen. Die meisten Menschen in Afrika schätzen es, wenn man sich für sie Zeit nimmt, sich für ihre Lebensumstände interessiert, wenn man seine Mitarbeiter besucht. Und dabei merkt man dann, wie sehr das Teilen für die Menschen dort wichtig ist Da verdient einer - und erhält eine ganze Großfamilie.
Und das erlebt man hier ganz anders. Hier spürt man, wie stark unsere Gesellschaft individualistisch orientiert ist. Die Freiheit, die wir hier beanspruchen (und die in vieler Hinsicht positiv ist), hat ein zweites Gesicht. Hier haben die meisten Menschen einfach zu wenig Beziehung zu ihren Mitmenschen, zur Nachbarschaft, zu den Mitarbeitern. An der Schule etwa, an der ich zunächst nach meiner Rückkehr unterrichtet habe, da haben die meisten einfach darauf geschaut, möglichst rasch und unbehelligt ihre Arbeit zu erledigen. Das war eine große Umstellung. In Zimbabwe gab es - vor allem an den kleineren Schulen - eine intensive Kooperation von Lehrern, Schülern und Eltern. Und noch eine dritte Beobachtung: die relativ große Nüchternheit und das vielfach geringe Engagement vieler Christen für die Kirche hier. Wer sich in Zimbabwe zur Kirche bekennt, investiert etwas in sein Glaubensleben. Viele - alte und junge - nehmen stundenlangen Anmarsch zum Gottesdienst in Kauf. Sie nehmen äußere Formen ernst, singen engagiert im Gottesdienst mit, bringen ihre Gebete freiformuliert ein. Da spürt man, daß sie ihren Alltag aus dem Glauben leben, sich als gläubige Gemeinschaft erleben. Für viele ist das Lesen der Bibel einfach selbstverständlich. Hier haben wir dann gespürt, daß all das etwas unterbelichtet ist.
Heinz Gattringer ist Mitarbeiter bei den Päpstlichen Missionswerken.