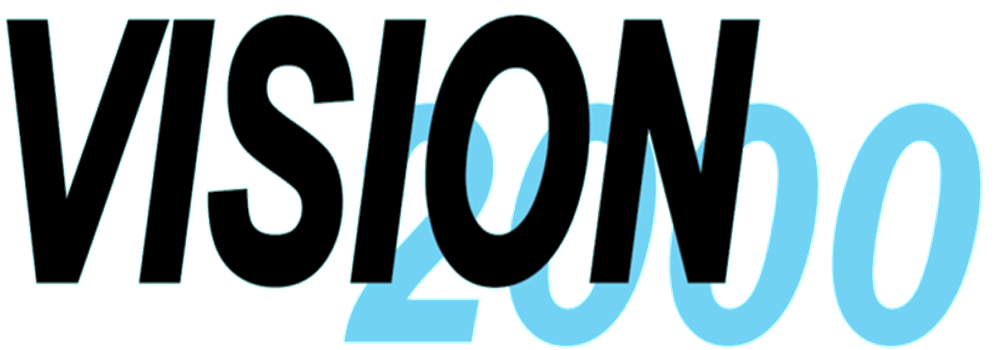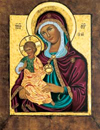Die Gesellschaft ist heute nicht mehr christlich geprägt. Die Versuchung, sich da anzupassen oder hinter Kirchenmauern zu verschanzen, ist groß. Der Aufruf zur Neuevangelisierung erfordert aber eine andere Haltung.
Die westliche Gesellschaft, auch ”Konsumgesellschaft" genannt, giert nach Reichtum, Laster und Macht. An den Christen ergeht aber nicht der Ruf zum Geist des Reichtums, sondem
zu dem der Armut. Er ist auch nicht zum Geist des Lasters, des Sexkultes, der Sinnlichkeit gerufen, sondern zur Liebe, zur einmaligen, zur treuen, zum Einswerden der Herzen, um Leben zu schenken. Und er ist schließlich nicht zur Beherrschung durch Macht, Ehre und Ruhm, sondern zum Geist des Gehorsams und der Demut berufen. Ist er also dazu verurteilt, allein zu bleiben, sich in seine Familie oder in heimelige Kapellen zurückzuziehen, ängstlich und in Verteidigungshaltung? Oder ist es umgekehrt seine Aufgabe, überall mitzumischen, als engagierter Christ für die Menschenrechte oder die soziale Gerechtigkeit zu kämpfen und locker in seinen Urteilen in Fragen der Sexualität und der Zuwendung zu sein? Oder ist er unausweichlich dazu verurteilt: sich dem Rhythmus der Welt anzupassen, nur um Präsenz zu signalisieren?
Keine der drei Varianten ist eine gültige Lösung.
Was also? Ich meine, daß man zur Kenntnis nehmen muß - und zwar mit ganzem Herzen und ein für alle Mal -, daß Christsein heute nicht mehr bedeutet, sich vor allem auf ein christliches Milieu zu stützen (das war einmal), sondern es heißt vor allem, auf die Gegenwart Gottes und auf das Wirken des Heiligen Geistes zu setzen: “Ohne mich könnt ihr
nichts tun”, hat Jesus den Aposteln gesagt. Ohne Ihn - nichts! Gar nichts. Aber wie soll man sich in seinem Inneren auf Ihn stützen? Man muß Ihn dort zuerst einmal
finden, wenn dies vorher noch nicht geschehen sein sollte. Das passiert selbstverständlich in der Stille, im Sakrament der Buße, der Eucharistie, und sehr oft wird die innerliche Gegenwart Gottes auf dem Grund der Seele dem inneren Blick des Glaubens erst bei einer Einkehr eröffnet. (“Es dauert fünf Tage, um eine Seele zu verändern”, hat die Gottesmutter einmal zu Marthe Robin gesagt).
Die Stille ist das Klima der Liebe. Es ist die Atmosphäre, die die Hingabe ermöglicht, die Hingabe an Gott. Es geht nicht darum, Ihm Versprechungen zu machen oder Ihn mit Geschenken zu überschütten. Die Gabe Gottes an den Menschen ist Gott selbst. Und gleichzeitig ist die Gabe des Menschen an Gott der Mensch:
Wer beschlossen hat, sich innerlich Gott auszuliefern, Ihm seine Freiheit zu übergeben, um Sein Werk der Liebe zu tun, der muß nach nichts anderem mehr suchen.
Er hat schon gefunden.
Wer auf diese Weise Gott gefunden hat und wem es zur Gewohnheit geworden ist, bei Gott Kraft zu tanken, der muß sich auf Ihn stützen, ... Was wir tun, wird durch Ihn, mit Ihm und in Ihm besprochen, beurteilt, verwirklicht - wie es den Worten der Eucharistiefeier entspricht...
Zu Pfingsten im Jahr 30 hat Jesus seine Jünger ausgesandt. Zum neuen Pfingsten vom August 1989 (dem Treffen mit der Jugend in Santiago de Compostela) hat Petrus, heute in der Gestalt des Johannes Paul II, eine Million anwesende Laien und viele im Geiste Gegenwärtige als Apostel in eine Welt von Milliarden Menschen gesendet.
Auch hier stellt sich die Frage: Wie soll man es angehen?
- Vor allem muß man sich in Erinnerung rufen, daß Apostolat nicht Werbung ist, keine Propaganda. Es geht nicht um eine Art Gehirnwäsche. Mir scheint, man könnte sagen,
Apostolat sei eine wirksame Form, Zeugnis abzulegen, ein Zeugnis, das manchmal Verwunderung auslöst, manchmal schockiert, aber Fragen aufwirft. Es ist dadurch wirksam, daß, wer davon berührt ist, durch das Wirken des Heiligen bewegt wird. Glaubenszeuge ist natürlich nur, wer selbst den Glauben lebt: Das Apostolat ist Ausdruck des überfließenden inneren Lebens. Selbstverständlich bedeutet es auch, intensiv für jene zu beten, deren Evangelisierung, ja mehr noch, deren Umkehr, also deren Hinwendung zu Jesus, man erbittet. Es gibt also gewissermaßen zwei Voraussetzungen: Das Glaubensleben des Apostels und sein Gebet für jene, die der Herr seinem Zeugnis zuführt.
- Als Jesus seine Apostel erstmals ausgesendet hat, schickte Er sie jeweils zu zweit auf den Weg. Und nach der Auferstehung hat es jeder Apostel genau so gemacht:
Bekehrt wurden zunächst jene, mit denen er gemeinsam die Herzen anderer zu gewinnen versucht hat. Der Satz: “Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen
sind...” ist zweifellos ein Schlüssel für jedes Apostolat in der Welt von heute. Diese Welt ist für das einsame Apostolat eines einzelnen einfach zu schwierig. Man
muß daher - das ist drängend - (mindestens) zu zweit sein.
- Bleibt die heikelste Frage: Wie soll man Zeugnis geben? Soll man schweigen? Reden? Und wie? Selbst ohne das Wirken des Herm, das Wort Gottes, anzuführen, ist doch einiges ins Treffen zu führen. Ich glaube nicht, daß am Pfingsttag Petrus und die Aposteln geschwiegen haben (aber sie hatten 10 Tage lang vorher mit den heiligen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, gebetet). Ich denke nicht, daß Paulus (er war zu wortgewandt) bei seinen Reisen geschwiegen hat. Aber bevor er zum Völker-Apostel wurde, hatte er sich monatelang in die arabische Wüste - wie Jesus - zurückgezogen, um sein öffentliches Wirken vorzubereiten.
Üblicherweise wird also das Wort, das auf Gebet und Stille aufbauende Wort, Träger des Zeugnisses sein. Es ist aber schwierig, das Wort in rechter Weise zu gebrauchen. Es gibt (zu) schüchterne Apostel, aber auch Nervensägen (man flieht sie). Es gibt auch Apostel, die Tugend und Moral, ja die Heiligkeit mit dem Vorschlaghammer einzubläuen
versuchen. Und schließlich gibt es Apostel, die, kraftlos, von der Welt besiegt werden: Das Salz hat seine Kraft verloren ...
Was tun? Kaum hat man Erfahrungen mit der Gnade gemacht, gibt es auch etwas zu bezeugen - weil Gebete ja erhört werden.
Bleibt das Wie. Wie bringt man Gott ins Gespräch? Jedenfalls: zwanglos! So natürlich wie möglich. Indem man von den Geschehnissen des Tages ausgeht, von einer erfahrenen Gnade Gottes: “Weißt du, was ich gerade erlebt habe...?” Und nach der Erzählung, spricht man von etwas anderem. Es ist unsinnig zu glauben, daß man Blumen zu
Wachstum anregt, wenn man an ihnen zieht. Man muß Zeit lassen ...
Und manchmal wird der Gesprächspartner darauf zurückkommen, von selbst.