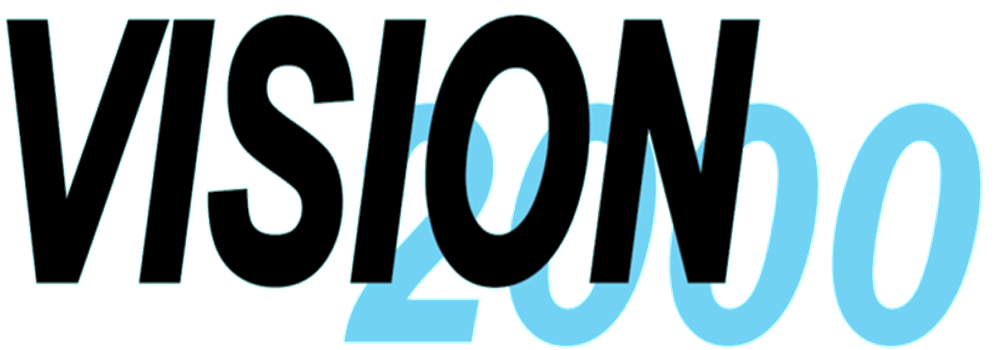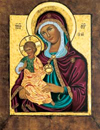Bemerkenswert selbstlos, furchtlos und nur auf Gott vertrauend: So erschien mir Jelena Brajsa, diese mütterliche Frau mit den lachenden Augen. Anders hätte sie wohl ihr großartiges Werk als Leiterin der Caritas Zagreb nicht vollbringen können.
Schon vor 5 Jahren, als ich sie beim Wiener Familienkongreß hörte, war ich, wie auch die tausenden Zuhörer damals, von ihrer Ausstrahlung und ihren Worten hingerissen. Diesmal ist sie nach Wien gekommen, um als erste den Preis der Waldheimstiftung entgegenzunehmen. Bei den Marienschwestern im 6. Wiener Bezirk habe ich sie interviewt.
Sie sei ein „echtes Zagreber Kind“ beschreibt sich Jelena. Ihr Vater war ein bekannter Advokat in Zagreb. Bekannt war die
Familie allerdings auch wegen der Anzahl an Kindern. Jelena war als 13. und letztes Kind geboren worden. Meist bekommt
sie dann zu hören: "Ja, früher konnte man so viele Kinder haben, aber heute nicht mehr,“
„Das ist nicht wahr“, antwortet sie dann, „das war immer schon schwer. Aber es ist eben ein Charisma. Es gibt Ehen, da ist ein Kind schon zuviel, und bei anderen (wie meinen Eltern), sind auch 13 nicht zuviel. Bei uns haben sogar immer wieder arme Studenten gewohnt und gegessen.“ Fragte man ihren Vater, ob es nicht zuviele Kinder seien, so lachte er stets: „Es hätten ja jedesmal Zwillinge sein können!“ An die Maxime ihres Vaters, in allem Gutes zu sehen, hält sich Jelena Brajsa immer noch - sowie an sein Wort, daß „jeder Tag, an dem nicht gelacht wird, ein verlorener Tag ist."
Für die Kommunisten war jedenfalls die Schülerin Jelena kirchlich viel zu aktiv: in Jugendgruppen, bei der Tauf- und Erstkommunionvorbereitung ... Das machte sie sehr verdächtig.
Wieso sie denn schon als junges Mädchen so aktiv gewesen ist, möchte ich wissen: „Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Das ist ein Charisma von Gott, daß ich eine Anziehungskraft für andere Menschen habe. Das hat den Kommunisten gar nicht gepaßt. Schon als Kind und junges Mädchen wurde ich von ihnen verfolgt und durfte nicht mit den anderen Kindern spielen. Und
mein Maturazeugnis im Jahr 1958 trägt den Vermerk, daß ich keine Universität besuchen dürfe.“
Was sie dann gemacht habe?
Sie kam nach Wien. Zuerst arbeitet sie da ein Jahr als Putzfrau und Bedienerin im Rudolfspital, bis sie vom „Seminar für kirchliche
Frauenberufe‘“ hört. Sie schreibt hin und fragt an, ob sie ein Stipendium bekommen könne, da sie ja über keinerlei Mittel verfüge. Man schickt ihr ein Formular, sie möge unterschreiben, daß sie in diesem Fall nach absolviertem Studium drei Jahre für die Diözese Wien arbeiten würde. Das könne sie nicht unterschreiben, war ihre Antwort.
„Ich bin ja ins Ausland gefahren, um zu lernen und möglichst schnell wieder heimzufahren, um meinem Volk zu dienen.“
Kardinal König liest den Brief und möchte die Schreiberin kennenlernen, die ihm dann ihre Situation erklärt und daß sie keinen Tag länger als nötig bleiben würde. Und sie bekommt ihr Stipendium. 1962 macht sie ihre Diplomprüfung und wird damit, was man heute Pastoralassistentin nennen würde.
Das politische Klima in ihrem Land bleibt aber zu gefährlich. So geht sie auf ein paar Jahre nach Frankreich. In Lourdes erhält sie eine theologische Ausbildung. 1966 aber ist das Heimweh endgültig zu groß. Sie fährt illegal heim. Zu Hause werden ihr zwei Arbeitsmöglichkeiten angeboten: Als Katechetin oder in der Caritas. Sie entscheidet sich für letzteres.
Der damalige Erzbischof von Zagreb, Kardinal Seper, unterstützt ihren Wunsch. Aber wie soll sie die Arbeit beginnen? Offiziell geht unter dem kommunistischen Regime gar nichts. „Zunächst wollten wir den Menschen zeigen, daß Gott sie liebt. Nur mit Worten allein
kann man das den Menschen aber nicht beweisen. Wenn sie Hunger oder Durst haben, wenn sie nackt sind, muß man handeln
- wie es in der Schrift steht. Es gibt übrigens kein besseres Lebensbuch. Wenn man nicht danach lebt, kann man kein religiöser
Mensch sein.”
So einfach klingt das, aber wie hat sie das umgesetzt, frage ich sie. Zunächst ganz auf sich gestellt: Sie sammelt alles, was niemand
sonst haben will: Kleider, Lebensmittel - sogar Menschen: Eines Morgens nämlich, als sie ins Büro kommt, findet sie eine Schachtel vor der Tür - und darin ein neugeborenes Kind, ein Findelkind! Sie behält es und empfindet es als Fingerzeig: Sich um Kinder zu kümmern, die niemand haben will (oder kann).
Erst sind es nur Findelkinder. Als sich aber herumgesprochen hat, daß sie jedes Kind aufnimmt, melden sich auch Spitäler, in denen Mütter Kinder bekommen, aber hergeben wollen. Ein Anruf bei Jelena genügt: „Ich habe die Kinder geholt, weil jeder Mensch das Recht zu leben hat.“ So kommt es, daß sie bis heute 1682 Babies aufgenommen hat. Einige hundert Kinder wurden zur Adoption freigegeben.
Manche sind später dann doch zur eigenen Familie zurückgekehrt.“
Als sie vor 29 Jahren begonnen hat, gab es keinen Platz für die Caritas. Kardinal Seper gab ihr daher zwei Räume in seinem Palais. Zu diesen beiden sind später viele andere dazugekommen.
Jelena schmunzelt: „Wir haben uns auf die Suche gemacht und viele schöne Räume entdeckt. Ich dachte mir nämlich, daß man von außen ja nur die Fenster sicht, aber nicht, was sich drinnen abspielt. So bin ich zu Kardinal Kuharic gegangen, habe ihm ein Baby auf den Tisch gelegt und ihn vor die Wahl gestellt, mir entweder weitere Räume zu geben, damit ich dieses und andere Kinder behalten könne, oder mir die Erlaubnis zu geben, das Kind zu töten.“ Natürlich bekommt sie die Räume.
1000 neugeborene Babys finden hier ihre erste Krippe. Der Kardinal selbst meinte einmal, dies sei wohl das einzige bischöfliche Palais der Welt, in dem täglich einige hundert Windeln trocknen.
Wie sie das alles finanziert habe, will ich von Frau Brajsa wissen. „Nur mit Spenden“, ist ihre Antwort. „Obwohl es den Menschen
damals so schlecht gegangen ist?“, frage ich weiter.
„Man hat doch eigentlich immer etwas, um zu teilen. Schauen Sie sich diese schöne Tischdecke an." Lächelnd deutet sie
auf die schöne Samtdecke des Tisches, an dem wir sitzen. „Wenn jemand sie dringend braucht, so kann dieser Tisch doch auch ohne die Tischdecke sein. Schön, daß sie da ist, aber der Tisch braucht sie nicht. Oder? Ist sie lebenswichtig? Vielleicht ist sie für jemanden,
der nichts zum Zudecken hat, dem kalt ist, lebenswichtig.” Das klingt so verblüffend einfach und praxisbezogen, daß ich fast
lachen muß. Sie führt fort: ”Es gibt so viel in einem Haushalt, das man mit anderen teilen könnte. Dinge, die man vielleicht nur einmal im Jahr in die Hand nimmt.“ Jetzt muß ich schmunzeln. Ich stelle mir gerade vor, wie Jelena bei uns zu Hause durch die Wohnung geht. Im Nu wäre diese um drei Viertel ihres Inhalts erleichtert - und auch mein Mann wäre es! Ein Vorsatz fürs nächste Jahr?
Zurück zu Jelena. Es gab auch Leute, die ihr den Vorwurf machten, sie solle sich nicht so viel um uneheliche Kinder kümmern. Unehelichkeit ist besonders bei den Slawen in ihrem Land ein lebenslanger Makel. Um darauf zu reagieren, geht sie eines Tages mit verschiedenen Neugeborenen in die Kirche und fordert die Leute auf, ihr zu zeigen, welches der Kinder nun Eltern habe und welches
nicht. Alle schauen sie komisch an. Niemand kann den Unterschied sagen. Es gibt ja auch keinen, und das haben die Leute in
der Kirche damals erkannt.
Viele der Kinder sind jahrelang bei ihr geblieben. Vor allem die behinderten. Jelena selbst hat sechs von ihnen adoptiert. Eines
davon fand sie in einem Spital - ein Mädchen, das als Einjährige in einem Wald gefunden worden war. Es litt jetzt an zerebraler
Paralyse. „Wie heißt Du?“, fragt Jelena sie. Das Kind darauf: „Jelena" - „Ja, wieso hast Du denn denselben Namen wie ich?“, fragt darauf die „große‘“ Jelena spaßhalber. Worauf die Kleine sagt: „Vielleicht bin ich von Dir ...“ Dieses Argument ist so überzeugend, daß die ”große” Jelena das Kind gleich am nächsten Tag mit nach Hause nimmt.
Bis heute hat diese bemerkenswerte Frau ihre Arbeit konsequent fortgesetzt.
Doch erst in den letzten paar Jahren spricht man in ihrer Heimat darüber. In der kommunistischen Ära war es gefährlich, über diese gänzlich illegale Organisation zu sprechen, ja überhaupt mit Jelena Brajsa bekannt zu sein. Mehrmals war sie eingesperrt,
immer wieder wurde sie zu äußerst unangenehmen Verhören abgeholt. Einmal war sie tagelang in einer winzigen Toilette eingesperrt. „Aber das macht nichts“, sagt sie im Rückblick überlegend, "da lernt man beten."
Schon vor zehn Jahren wurde es leichter. Sie bekommt einen Paß und kann ins Ausland reisen, von wo sie auch Hilfe bekommt.
„Seit 1988 haben wir schon gespürt, daß der Kommunismus nicht mehr allzu lange dauern würde.” 1990 kam dann der Bruch. Jetzt in der Demokratie sind sie eine anerkannte, humanitäre Organisation. „Aber schon am nächsten Tag kam der Krieg. Er ist grausamer als die beiden Weltkriege. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja und Zagreb beherbergt jetzt 126.000 Flüchtlinge! Die müssen doch jetzt ernährt werden!“
„Wie hat sich Ihr Aufgabenbereich verändert?“, frage ich Jelena. Die Sorgen um die vielen Notleidenden sieht man ihr an, als sie erzählt: „Für Kinder zu sorgen, bleibt unsere wichtigste Aufgabe, sie ist aber nicht unsere einzige. Jetzt haben wir auch Flüchtlingslager, Häuser für Waisen und Halbwaisen. Es gibt leider viele verlorene Kinder, die nicht wissen, ob ihre Eltern leben. Allein in Kroatien gibt es
13.000 verschwundene Menschen. Wenn davon nur die Hälfte zurückkommt, ist das schon schön. Wir geben daher jetzt auch keine Kinder zur Pflege oder Adoption.“
Auch um Frauen, die vergewaltigt oder mißhandelt worden oder einfach in Not sind, kümmert sich die Caritas jetzt besonders: „Heuer haben wir sieben Familienhäuser in der Stadt gekauft. In jedem wohnen mindestens 10 Frauen mit ihren Kindern. Wir versuchen, sie in ihre Umgebung zu integrieren.“
Auf die Frage, wieviele da mithelfen, höre ich, daß derzeit 137 vollamtliche Mitarbeiter bei der Caritas tätig sind, aber auch viele
freiwillige Helfer, die etwa als mobile Beratungstellen in Gruppen zu viert in der ganzen Stadt wirken, auf der Straße Beratung anbieten oder Flüchtlingslager besuchen. Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern und Sozialarbeiterinnen versuchen zu helfen, etwa den vielen Frauen mit Depressionen, als Folgen von Vergewaltigung und Abtreibung.
Wieviele Häuser denn die Caritas jetzt betreibe? „Derzeit haben wir 16 Häuser für Kinder, kinderreiche Familien und Frauen. Es gibt auch zwei Containersiedlungen, die sicher nicht 100 Jahre halten werden, aber bis Kriegsende ... Jetzt werden wir noch ein Containerstockhaus bekommen. Da können wir weitere 70 Frauen mit Kindern unterbringen oder alte Menschen. Es
ist schrecklich, wieviele alte Menschen jetzt auf den Straßen leben und dort auch sterben.“
Mit sehr viel Freude berichtet sie von einem Projekt für die vielen im Krieg verletzten Kinder: „Damit diese Kinder eines Tages
sich selbst erhalten können, ohne anderen auf der Tasche liegen zu müssen, bauen wir auf 5000 Quadratmetern 10 Einfamilienhäuser,
in denen je 12 Kinder leben werden.“ Je nach Begabung sollen sie dann später in Sonderschulen geführt werden und anschließend für sie auch Arbeitstellen gefunden werden.
„Ach wäre der Krieg doch bald vorbei“, sage ich, worauf Jelena entschieden antwortet: „Das wäre wunderbar, aber ich kann nicht darauf warten. Wenn ich das mit einem Kind vergleiche: Sehen Sie, ein 6jähriges Kind braucht heute eine Torte mit 6 Kerzen nicht nächstes Jahr. Da braucht es nämlich schon 7. Wir müssen heute so arbeiten als wäre der Krieg schon zu Ende. Sonst verlieren wir tausende
Menschen. Sonst ist alles zu spät.“
Dann erzählt sie voller Kummer von den tausenden von Kindern und alten Menschen, die in diesem Krieg massakriert worden
sind. „Das kann nicht ewig so weitergehen. Auch für uns muß wieder die Sonne scheinen. Ich denke folgendes: Der liebe Gott weiß, daß wir ein treues Volk sind, das mit Christus leidet. Vielleicht gibt er uns deswegen so viel zu leiden. Jemand muß auch leiden. Gott weiß, wem er ein Kreuz gibt. Es kann nicht jeder so ein Kreuz tragen. Aber ein ganzes Leben lang kann man nicht Simon von Cyrene sein. Von ganzem Herzen kann ich aber sagen: Ich war noch nie so stolz, Mitglied der katholischen Kirche zu sein. Was die Kirche bei uns in den letzten drei Jahren für das Volk getan hat, ist wunderbar. Wir öffnen die Türen der Kirchen, um daraus ein Spital zu machen oder Kinderheime."
Woher nimmt Jelena nur die Kraft? "Der Glaube an Gott. Man muß nur glauben und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Dann sieht man, wie - oft ganz unerwartet - sich die Liebe Gottes, dieses Kommen Christi zu uns, verwirklicht. Und im Grunde genommen, ist jeden Tag Weihnachten - und jedes Kind ein "Christkind"."
Hätte Jelenas Mutter nicht auch noch dieses 13. Kind bekommen, so gäbe es diese Jelena nicht. Dann wären 1682 Kinder ohne Heim geblieben oder hätten nicht einmal überlebt, und viele andere Menschen wären vielleicht verloren gewesen.
Nach diesem Gespräch mit ihr umarme ich sie, gebe ihr ein Bussi und füge entschuldigend hinzu: "Weil Sie doch soooo eine liebe Frau sind."
Wie kann man spenden? In Leibnitz (Steiermark) hat Jelena bei der Raiffeisenbank das Konto 73395. Sie bekommt aber auch
Spenden, die bei der Caritas mit dem Vermerk "Jelena Brajsa" eingezahlt werden.