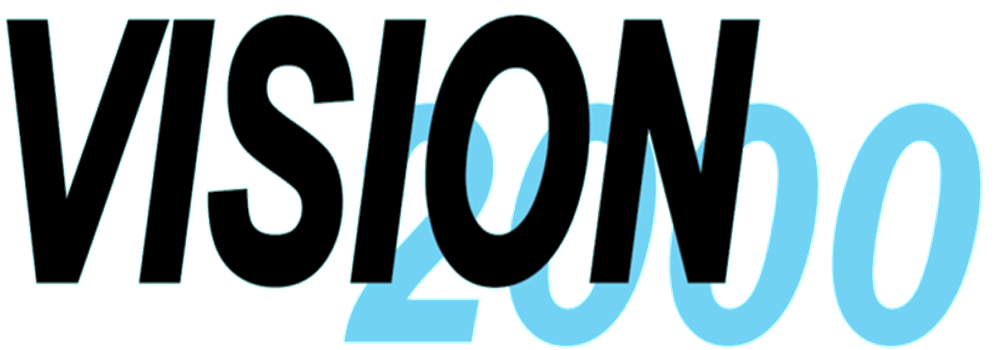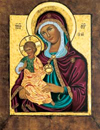Ein junger Mann legte seinem vermögenden Vater als letzten Besitz seine Kleider vor die Füße und lebte die Nachfolge Jesu in seiner radikalsten Form entsprechend dem Rat Jesu an den reichen Jüngling (vgl. Mk 10,21); es war Franz von Assisi!
Ein anderer junger Mann wurde von Gott auserwählt, vom Propheten Samuel gesalbt und mit 30 Jahren König von ganz Israel. Er wurde immer mächtiger und reicher (vgl. 2 Sam 5,10); es war der Hirtenknabe David. Der Sohn eines reichen Kaufmannes lebte in äußerster Armut und der arme Hirtenknabe David erlangte unermeßlichen Reichtum.
Die Gefährlichkeit des Reichtums zeigt das Gleichnis vom reichen Prasser und vom armen Lazarus (vgl. Lk 16,19). Jesus sagt, daß ein Kamel “eher durch ein Nadelöhr geht, als daß ein Reicher in das Himmelreich kommt" (Mk 10,25). An anderer Stelle aber lobt Jesus jene Diener, die mit ihren Minen Geschäfte machten und weitere Minen erwirtschafteten (vgl. Lk 19,16).
Ja, Jesus rät sogar, uns “mit Hilfe des ungerechten Mammons" (Lk 16,9) Freunde zu machen. Sowohl nach dem Gleichnis vom reichen Prasser als auch nach jenem vom geschäftstüchtigen Diener antworten wir in der Kirche mit “Lob sei dir, Christus!"
Wir ehren den König David und den Bettler Franziskus und wir setzen nicht den einen über den anderen. Der heilige Paulus konnte sich in jeder Lage zurechtfinden, er konnte Entbehrungen ertragen und im Überfluß leben. “In alles", sagt er “bin ich eingeweiht: in Sattsein und Hunger, Überfluß und Entbehrung" (Phil 4,12).
Entscheidend für den Christen sind nicht Reichtum oder Armut, sondern das Befolgen des göttlichen Rufes. Gott führt Franziskus vom Geschäft seines Vaters in die Armut, den Hirten David von seiner Herde in den Königspalast und den Christenverfolger Saulus zum Völkerapostel Paulus. Für alle drei gilt der Satz des Paulus: “Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt." (Phil 4,13)
Reichtum und Armut für sich alleine gesehen sind neutral und stellen noch keinen religiösen Wert dar. Der weise König Salomo schreibt: “Gib mir weder Armut noch Reichtum, nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht, satt geworden, dich verleugne und sage: Wer ist denn der Herr?, damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife" (Spr 30,6).
Ähnlich lautet ein Text der Konzilsdokumente, nach dem der Mensch “weder durch den Mangel an zeitlichen Gütern niedergedrückt, noch durch deren Fülle aufgebläht" (Laienapostolat 4) werden soll.
Bei der Frage nach Gott oder Mammon geht es nicht um die Qualität des Mammons beziehungsweise Reichtums, sondern um dessen rechten Gebrauch (vgl. Lk 16,9). Die hebräische und auch aramäische Bedeutung des Wortes Mammon kann man mit “das, worauf jemand vertraut" übersetzen. Bei dieser Übersetzung wird das Wort Jesu: “Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon" (Lk 16,13) mehr verständlich.
Wir können nicht auf Gott vertrauen und gleichzeitig auf den Mammon, das eine schließt das andere aus! Wer den Mammon über Gott stellt, betreibt, wie wir im Katechismus lesen können Götzendienst, denn “es ist Götzendienst, wenn der Mensch anstelle Gottes etwas Geschaffenes ehrt und verehrt, ob es sich nun um Götter oder ... Geld oder ähnliches handelt" (Kat 2113).
Dieser “Götzendienst läßt Gott nicht als den einzigen Herrn gelten; er schließt also von der Gemeinschaft mit Gott aus" (ebd.). Niemand soll sich auf seinen Besitz verlassen und sich seines Reichtums rühmen (vgl. Ps 49,7) oder das Herz an den Reichtum hängen (vgl. Ps 62,11), denn “wer auf seinen Reichtum vertraut, der fällt" (Spr 11,28), er gerät in Versuchungen und Schlingen und verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden (vgl. 1 Tim 6,9).
Die wahren Schätze sammelt man nicht hier auf der Erde, “wo Motte und Wurm sie zerstören" (Mt 6,19), sondern im Himmel.
Franz von Sales, der Heilige des Gleichmaßes, gibt in seiner Philothea eine weise Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zum Reichtum. Er sagt: “Wenn du solche (Güter) besitzt, so sollst du dabei die innere Freiheit bewahren. Das Herz soll nicht der Sklave der Dinge werden; denn du sollst über sie herrschen. Es ist etwas anderes, Gift zu haben, und etwas anderes, selbst vergiftet zu sein. Du kannst Geld im Geschäft und im Hause haben, ohne daß es dein Herz einnimmt. Es ist sogar ein großes Glück für den Christen, Vermögen zu haben und arm im Geiste zu sein. Denn er kann seinen Reichtum zum Guten verwenden und hat noch den Lohn der Armut dazu. Ich billige es durchaus, daß Du auf Mehrung deines Vermögens sinnest - vorausgesetzt, daß es nicht nur gerecht, sondern auch sanft und liebreich geschehe."
Wer auf den Mammon schaut, ist wie Adam und Eva, die ihren Blick von Gott weg zur Schlange richteten und dadurch von Gott weggezogen wurden. Wir dürfen mit beiden Füßen auf der Erde stehen und auch die Hände im Geschäft haben, aber unser Haupt, vor allem aber unser Herz, müssen bei Gott sein.
Gott ist ein “eifersüchtiger Gott" (Ex 20,5), und deshalb darfst du dich “nicht vor einem anderen Gott niederwerfen" (Ex 34,14). Jakobus schreibt: “Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes" (Jak 4,4), denn Gott sehnt sich “nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ" (Jak 4,5). Gott will nicht, daß wir unser Herz an den Mammon verlieren, er sehnt sich danach, daß wir es ihm öffnen.
Jesus sagt: “Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz" (Mt 6,7). Wer zu sehr mit der Welt beschäftigt ist, kann sogar zum Gottesdienst gehen, ohne Gott zu begegnen. Auch mich haben manchmal weltliche Sorgen bis in die Messe hinein so verfolgt, daß ich sogar die Wandlung übersah, denn mein Herz war in der Welt, die mich zu sehr gefangen nahm.
Gott will den ersten Platz einnehmen, bei Franziskus, König David, dem Apostel Paulus und bei mir! Die heilige Elisabeth verkauft ihren Besitz und dient den Armen und Kranken. Die heilige Hemma von Gurk verkauft ihren Besitz nicht, denn sie will mit ihren Gütern nach ihrem Willen Gutes tun.
Auch heute hören viele Menschen auf Gott und geben ihm den ersten Platz. Ist es nicht schön, wenn Mutter Teresa von einem indischen Brautpaar berichtet, das aus Liebe zu Gott auf eine in Indien übliche, prunkvolle Hochzeit verzichtet und ganz einfach heiratet, um das so ersparte Geld den Armen zu geben?
Ein Millionär verkauft seine Firma und schenkt den Erlös apostolischen Organisationen. Ein anderer Unternehmer führt das Geschäft mit Erfolg weiter und unterstützt mit seinen Einkünften Arme, Kranke und Missionare.
Ein junger Ehemann verzichtet auf eine lukrative Versetzung in eine andere Abteilung, weil er - durch die damit verbundenen Auslandsreisen - die vor Gott geschlossene Ehe gefährdet findet. Ein Architekt riskiert sein Vermögen und seine Karriere beim Aufbau eines verfallenen Klosters. Junge Burschen und Mädchen, meist sehr gebildet, verlassen alles und treten in arme und strenge Gemeinschaften ein, um nur von der Vorsehung zu leben. Sie alle vertrauen Gott und nicht dem Mammon.
Wenn wir nicht dem Mammon, sondern Gott dienen, dann ist uns der Segen Gottes gewiß, und “der Segen des Herrn macht reich!" (Spr 10,22). Es ist paradox, aber doch wahr: Wer nicht dem Reichtum dient, sondern Gott, der erhält dafür Gott und Reichtum! Der Herr weiß ja, was wir alles brauchen.
Das ist ja das Geheimnis des christlichen Abendlandes und der abendländischen Kultur: Das einst christliche Europa diente Gott und wurde reich!
Ein Student aus Afrika antwortete auf die Frage des Professors, warum wohl Europa die Wurzel der modernen Zivilisation wurde, mit dem Satz: “Ihr habt den stärkeren Gott!" Ja, wer diesem Gott dient, wird reich. Wenn die Menschheit Gott an die erste Stelle setzen und die Menschen mit dem ungerechten Mammon Gutes tun würden, dann würde uns “alles andere dazugegeben" (Mt 6,33) werden!