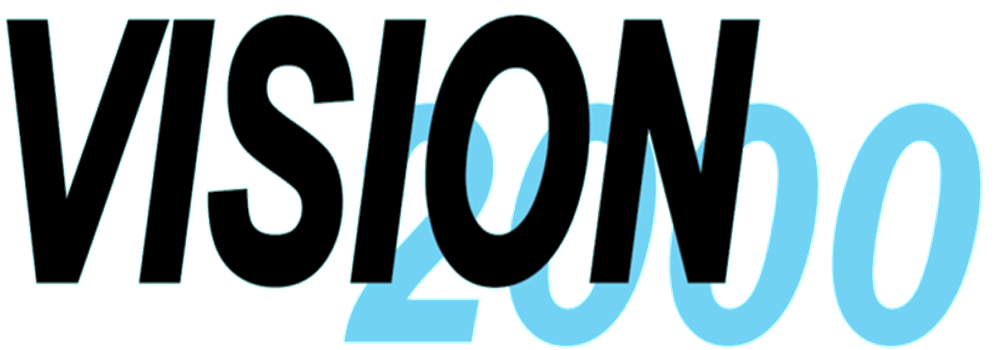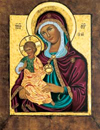Warum mußte ich über 60 werden, um ins Heilige Land zu pilgern? Mit 18 war ich schon mal dort zum Äpfelpflücken im Kibbuz Nir Am am Gazastreifen. Wir wurden auch ein paar Tage durchs Land kutschiert. Jesus fand dabei keine Erwähnung.
Juden haben Sehnsucht nach Jerusalem, Muslime wissen, daß sie einmal im Leben nach Mekka pilgern sollen; warum drängt es nicht jeden Christen zu den Stätten und Steinen, die Zeugnis geben für das Leben und Leiden unseres Herrn?
Wir sind eine Gruppe von gut dreißig Pilgern, die – geschart um Pfarrer Konstantin Spiegelfeld – Ende Januar 2010 das Flugzeug nach Tel Aviv besteigt. Nach Mitternacht passiert unser Bus den Spalt in der Mauer nach Bethlehem, einer Mauer, die Schutz ist für Israel und eine Schlinge für die besetzten palästinensischen Gebiete. Ohne zu suchen, finden wir Herberge in der Casa Nova in Bethlehem, direkt neben der Geburtskirche. Diese befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft einer Moschee, von der der Muezzin bereits um fünf Uhr früh lautsprecherverstärkt zum Gebet ruft. Ich kann die Schweizer verstehen. Wie freundlich sind doch unsere Glocken. Nur leider folgen weniger als zehn Prozent der Christen ihrem Ruf.
Wir beginnen unsere Tour des Staunens auf dem Hirtenfeld, einem kleinen Park mit einer Kirche. Hier also hat der Engel den Hirten die große Freude verkündet, die allem Volk widerfahren wird. Hier? Wirklich hier? Je mehr diese Frage durch die machtvolle Wirklichkeit der Steine, Felsen, Säulen, freigelegten Mauerwerke, Grafitti, Symbole, Münzen mit Ja beantwortet wird, umso stärker wird das Empfinden, daß meine seelische Kapazität für die Größe des Ereignisses, das hier, genau hier, stattgefunden hat, nicht ausreicht. Es ist ja auch wirklich nicht zu fassen, daß Gott Mensch geworden ist. Hier hat er gelehrt, gelitten, ist auferstanden und hat den Samen für seine Kirche gelegt, so klein wie ein Senfkorn.
Wir werden eine Woche lang von Karl-Heinz und Louisa Fleckenstein geführt, er Deutscher, sie christliche Palästinenserin. Als Archäologen und Bibelwissenschaftler sichern sie die Spuren Jesu durch Ausgrabungen und in den Herzen der Menschen, die sie führen – mit Wissen, Glauben und Humor. Sie sind zu Hause in den Sprachen und Kulturen, die hier zusammen leben, zusammen stoßen, zusammen leiden und keinen Frieden finden können. Sie verstehen sich als Brückenbauer und möchten, daß auch wir in diesem Geist auf den Spuren Jesu unterwegs sind. Jesus sagt uns: „Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet (Mt 5,44).“
Wir müssen uns tief bücken, um durch das niedrige Seitenportal ins Halbdunkel der Geburtskirche zu schlüpfen. Vor der großen, süßen Marienikone beten Christen und Muslime. Noch einige Stufen tiefer hinab zu dem vierzehnzackigen Stern. Ich muß mich hinknien um meine Hand durch die Öffnung in der Mitte des Sterns zu stecken und die Stelle zu berühren, auf der einst die Krippe stand. Der Säugling, der darin lag, wird sich dreiunddreißig Jahre später selbst zum Brot machen, das Christen nährt bis zum Ende der Welt.
Am Sonntag feiern wir zusammen mit palästinensischen Christen die Heilige Messe. Jedes der 120 Kinder bekommt am Schluß vom Pfarrer eine Tüte mit Süßigkeiten, ein Mittel der Evangelisation, das Armut zur Voraussetzung hat. Wir kommen ins englische Gespräch mit einer Familie. Der Mutter steigen Tränen in die Augen, als sie davon spricht, daß sie nicht nach Jerusalem dürfen und viele der Not der Arbeitslosigkeit nur durch Auswanderung entfliehen können.
Dagegen kämpft erfolgreich der Priester der Ortschaft Taybeh, nordwestlich von Jerusalem, dem Efraim der Bibel, wohin sich Jesus vor seiner Passion mit den Jüngern zurückgezogen hatte. Es ist das einzige Dorf in Palästina, das seit Menschengedenken rein christlich ist. Abuna, wie der Priester auf Arabisch genannt wird, Abuna Raed hat in Rom Philosophie und Theologie studiert. Um die Christen in Taybeh zu halten, ist er als Gemeindepriester zum business man geworden und hat eine große Olivenölproduktion und Bierbrauerei aufgezogen. Wir sollen kommen und unsere christlichen Brüder, die Nachkommen der Urchristen, nicht allein lassen, wenn uns daran liegt, daß im Land Jesu die christliche Tradition bewahrt bleibt. Dasselbe sagt uns Bischof Boulos, der uns in Nazareth empfängt. Kein Jammern, kein Klagen, obwohl es dafür Grund genug gäbe, reich gedeckte Tische und immer wieder das Wort Würde, die beim Helfen zu wahren sei.
Wir nähern uns Jerusalem von Seiten der Gräber. Ein ganzer Hügel auf dem Berg gegenüber der Stadtmauer ist mit steinernen Sarkophagen bedeckt, auf denen Steine liegen zur Erinnerung an die Wüste, durch die Moses sein Volk ins Gelobte Land geführt hat. Nichts Grünes, nichts Liebliches, purer Tod. Nicht weit davon die Kirche „Dominus flevit“. Hier stand der Herr und weinte: „Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt (Lk 13,34).“ Und wieder und wieder und wieder wollen wir Menschen nicht und bereiten uns so das Tal der Tränen.
Bei Jesus waren diese Tränen Blut, als er sich am Abend vor seinem Leiden auf dem Felsen, den wir mit der Hand berühren, in qualvoller Verlassenheit, seine schlafenden Jünger um Beistand anflehend, dem Willen des Vaters ergab.
Schließlich – erst zwei Tage sind vergangen – stehen wir in den Toren Jerusalems, genauer im Damaskustor, und tauchen in das arabische Viertel ein, um zum Österreichischen Hospiz zu gelangen. Als wir am nächsten Morgen auf dem flachen Dach Gott loben, geht die Sonne über Jerusalem auf; wir schauen auf die Schattenseite des Felsendoms im Osten und die Sonnenseite des goldenen Kreuzes auf der Grabeskirche im Westen, dem größtem Heiligtum der Christenheit. Über die Via Dolorosa, eine lärmende Geschäftsstraße mit versteckten Kapellen an einigen der Kreuzwegstationen, steigen wir hinauf nach Golgatha. Der gespaltene Felsen liegt im Gipfelpunkt der Grabeskirche, die besser Auferstehungskirche heißen sollte, denn das Grab ist so leer, wie es am Ostermorgen vor zweitausend Jahren war. Wir küssen die Steinplatte, auf welcher der Leichnam Jesu lag.
Sieben Christenheiten haben Verantwortung für diese Kirche – ein buntes Gewirr von Sprachen, Trachten, Riten, Altären, Bildern und Ikonen. Man kann sich nachts in die Kirche einsperre lassen – „es ist immer was los“, sagt Abuna Konstantin, der es getan hat.
Weiter zum Zionsberg, über den gotischen Abendmahlssaal, die erste Synagogenkirche, das Davidsgrab zur Dormitioabtei, der Entschlafung Mariens. Jeder Stein, jeder Ort treibt seine Wurzeln in die historischen Ereignisse der Selbstoffenbarung Gottes und ist umweht vom Wind der Verheißungen, der jeden anhaucht, der „hinaufzieht zum Hause des Herrn“. Die 1931 geweihte Kirche Gallicantu wölbt sich über das Apostel Gefängnis und das Verlies, in das Jesus nach seiner Gefangennahme gefesselt hinab geworfen wurde, wissend, was kommen würde. Beim Hahnenschrei „wandte sich der Herr um und blickte Petrus an“ (Lk 22,61). Bis ins Mark erschüttert, erkannte Petrus, daß er ihn in derselben Nacht doch verleugnet hatte.
Nach zwei Nächten und einem Tag sitzen wir bereits wieder im Bus und fahren dreißig Kilometer westlich von Jerusalem nach Emmaus, ein Weg, den die Jünger nach der Kreuzigung, aller Hoffnung beraubt, zu Fuß gegangen sind. „Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloß (Lk 24,32)?“ fragen sie, nachdem sie den Herrn am Brotbrechen erkannten. Aber da war der Auferstandene schon wieder verschwunden. Auch wir erkennen den Herrn, wenn uns der Priester das gebrochene Brot vor Augen hält: „Lamm Gottes, das du hinweg nimmst die Sünden der Welt.“ Hier in Emmaus, haben die Fleckensteins gegraben und wurden fündig. Aber sie mußten die Mosaiken wieder zuschütten, weil es niemanden gab, der ihre Konservierung bezahlt hätte.
Wir wenden uns wieder nach Osten, fahren durch die judäische Steinwüste hinunter zum Toten Meer, dem tiefsten Punkt der Erde, und von dort hinauf ins Jordantal. Aber da ist lange kein Jordan, erst weit nach der Oase von Jericho mit fächelnden Palmen, vorbei am Berg der Versuchungen, überqueren wir ein Flüßchen, dessen Ruhm in krassem Gegensatz zu seiner Schmächtigkeit steht. Sein Wasser wird in die israelischen Plantagen geleitet, so daß kaum mehr etwas bleibt für die Palästinenser und im Toten Meer fast nichts mehr ankommt.
Nach und nach wird es grün, wir gelangen an den See Genezareth ins liebliche Galiläa. Die letzten drei Nächte wohnen wir im Kibbuz Nof Ginnosar, nicht weit von Kafarnaum. Jesus hatte sein Heimatdorf verlassen, denn dort wollten sie ihn, den sie nur als gotteslästerlichen Anmaßer verstehen konnten, vom Felsen stürzen. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen.
Nazareth ist heute eine Stadt. Es ist auch immer wieder eine Enttäuschung, wenn die Bilder, die man sich unwillkürlich zu den Evangelien gemacht hat, so gar nicht zur heutigen Realität passen. Über die Grotte, in der Maria das größte Ja der Menschheitsgeschichte gesprochen hat, wölbt sich eine gewaltige Betonkirche an deren Wänden sich die Nationen mit meterhohen Keramik-Darstellung der Mutter Jesu verewigt haben. Habt ihr Architekten denn gar kein Gefühl gehabt für die Schlichtheit und Schönheit und Demut der Theotokos? Maria trumpft nicht auf, Anmut ist ausgegossen über ihre Lippen.
Am Ufer des Sees Genezareth hat Jesus seine Jünger berufen, hat Blinde und Lahme geheilt, die Fünftausend gespeist, den Sturm gestillt, ist übers Wasser gegangen, hat jene selig gepriesen, die ein reines Herz haben. Wir feiern die Heilige Messe an der „Mensa Christi“. Hier hat der auferstandene Herr seinen Jüngern, die trübe fischten und nichts fingen, zugerufen: „Werft das Netz auf der rechten Seite aus, und ihr werdet etwas fangen (Joh 21) !“ „Es ist der Herr!“ ruft Johannes aus, den die Liebe sehend machte.
Als die Jünger mit dem Auferstandenen gegessen hatten, fragt Jesus den Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte, dreimal: „Liebst du mich?“ und gibt ihm dreimal den Auftrag: „Weide meine Schafe!“
Dieser Auftrag gilt bis heute für jeden Nachfolger Petri und ist mit der Verheißung besiegelt: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen (Mt 16,18).“
Um ein Uhr früh müssen wir aufstehen, um den Israelis am Flughafen drei Stunden Zeit zu geben, sich von unserer Ungefährlichkeit zu überzeugen.
Es war nur wie ein Vorkosten des Heiligen Landes, dieses gordischen Knotens unserer Welt, der Völker, Kulturen und Religionen zusammenzwingt. Jedes Volk sieht seine unvereinbaren Ansprüche durch die Geschichte gerechtfertigt, jede Religion glaubt im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Wie kann Frieden werden, ohne sich im Relativismus selbst aufzugeben? Aber bringt denn der Relativismus, den die westliche Welt zur Religion gemacht hat, den Frieden? Nicht die Glaubenssätze und –gesetze bringen den Frieden, sondern einzig und allein, wenn sie wahr werden in der Bereitschaft, zu vergeben und zu lieben. Dazu ist Jesus Mensch geworden.