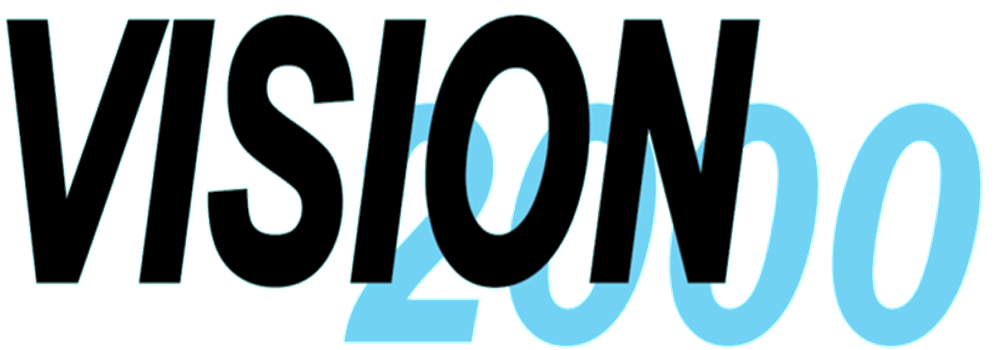Überraschender Wintereinbruch! Ausgerechnet jetzt, da wir nach Oberösterreich unterwegs sind, um in der Pfarre Neumarkt am Hausruck Bruder Philemon Kleinöder zu treffen. „Zufällig“ hatte ich in Radio Maria einen Teil einer von ihm gestalteten Sendung gehört: Er sagte gerade ungefähr Folgendes: „Am schönsten war Weihnachten im Gefängnis. Da war ich ganz allein mit dem Herrn.“ Ich fand das überraschend aus dem Mund eines Ordensbruders. So habe ich mich auf die Suche nach ihm gemacht. In Neumarkt habe ich ihn dann getroffen und mich schon auf die Begegnung mit diesem Mann gefreut. Es gehört zu seiner Mission, aus seinem Leben zu erzählen, um Jugendliche davor zu bewahren, in dieselben Fallen zu tappen wie er. Mit seiner so sympathischen, wohlklingenden Stimme erzählt er dann.
Überraschender Wintereinbruch! Ausgerechnet jetzt, da wir nach Oberösterreich unterwegs sind, um in der Pfarre Neumarkt am Hausruck Bruder Philemon Kleinöder zu treffen. „Zufällig“ hatte ich in Radio Maria einen Teil einer von ihm gestalteten Sendung gehört: Er sagte gerade ungefähr Folgendes: „Am schönsten war Weihnachten im Gefängnis. Da war ich ganz allein mit dem Herrn.“ Ich fand das überraschend aus dem Mund eines Ordensbruders. So habe ich mich auf die Suche nach ihm gemacht. In Neumarkt habe ich ihn dann getroffen und mich schon auf die Begegnung mit diesem Mann gefreut. Es gehört zu seiner Mission, aus seinem Leben zu erzählen, um Jugendliche davor zu bewahren, in dieselben Fallen zu tappen wie er. Mit seiner so sympathischen, wohlklingenden Stimme erzählt er dann.
1960 sei er in einem Vorort von Nürnberg geboren. Dort haben die Eltern, eine ältere Schwester und ein jüngerer Bruder sowie die Mutter des Vaters gewohnt. Als kleiner Bub hat er die Spannungen in der Familie nicht so gespürt, wohl auch, weil man als Kind das Geschehen rundherum für normal hält. Erst mit 10, 11 Jahren wurde ihm bewusst, „dass es zu Hause nicht so rosig ausschaut.“ Obwohl nach außen alles normal, nach einer intakten Familie gewirkt hat: der Vater ist Jäger, die Familie geht sonntags in die Kirche, der Vater singt im Kirchenchor, der Bub ist Ministrant, später in der katholischen Landjugend. Damals ist Heintje sehr populär und auch der kleine Heinzi – Heinz ist Br. Philemons Taufname – hat eine schöne Stimme und singt gerne dessen Lieder. „Der liebe Bub,“ sagen dann die Nachbarn gerührt.
Doch wie steht es wirklich um die Familie? Der Vater ist Alkoholiker und lässt, wenn er betrunken heimkommt, seinem Unmut freien Lauf: Da fliegt schon mal ein Teller mit zu lauwarmer Suppe an die Wand, oder er verprügelt eines der Kinder. Heinzi, ein sensibler Bub, ist dieser Atmosphäre nicht gewachsen: „Ich war innerlich zerwühlt.“ Er ist froh, wenn er dem Vater entwischen kann.
Dann entflieht er ins nahe gelegene Nürnberg und fühlt sich dort am Bahnhof bei ein paar Jahre älteren Jugendlichen geborgen. Die größeren Buben scheinen Verständnis für seine Situation zu haben. Mit 14 ist der Bahnhof dann jeweils für einige Stunden sein gewohnter Rückzugsplatz. Zu Hause fragt niemand, wo er sich aufhält.
Eines Tages entflieht er wieder der Situation zu Hause. „Geht es dir schlecht, hat dich dein Alter wieder verprügelt,“ fragt ihn einer der Burschen, „Komm rauch einmal eine!“ Was er angeboten bekommt ist allerdings nicht der „Tschick“, den er erwartet, sondern ein Joint (Haschisch).
Wie war das? „Ich sage den Jugendlichen, wenn ich in einer Schule davon erzähle: ‚Wißt ihr, diesen ersten Joint zu rauchen, war das Geilste, was ich in meinem Leben bis dahin erlebt hatte: Warum? Weil in dem Moment, wo ich das geraucht habe, die Realität einfach weg war: Ich war nur mehr lustig drauf. Die halbe Stunde, die das angehalten hat, war super!“ Klar, dass das nach Wiederholung schreit: „Wenn mein Vater ausgeflippt ist, bin ich zum Bahnhof und habe einen Joint geraucht.“ Umsonst? „Ja, anfangs war das gratis, doch eines Tages heißt es: Jetzt zahl einmal! Wie zahlen? frage ich nach. ‚Dachtest du, du kriegst das umsonst?’ hieß es nun. Doch ich habe die Joints – 5 bis 10 DM das Stück – mittlerweile gebraucht. Da ist zunächst mein Taschengeld draufgegangen.“
Bald fährt er auch zum Bahnhof, obwohl zu Hause kein Sturm wütet. Doch die Wirkung lässt, je öfter er raucht, immer schneller nach: Bald ist nach 10 Minuten alle Leichtigkeit verflogen. Also raucht er mehr. „Mehr bedeutet aber mehr Geld.“ So verwendet er bald nicht nur sein eigenes Taschengeld, sondern auch das der Geschwister. Bald muss auch der Kassettenrecorder seines Bruders herhalten und dann der Fernseher der Eltern: Mit „Ich werde in der Schule erpresst,“ erklärt er der Mutter den Diebstahl, die nun ihrerseits dem Vater erzählt, das Gerät fehle wegen eines nicht zu behebenden Defekts.
Rückblickend sieht er, wie er seine Mutter in sein Lügengespinst einbezogen hat. „Drogensucht betrifft ja niemals nur den Abhängigen allein, sondern wirkt sich auf die ganze Familie aus,“ erklärt er mir später im Lauf unseres Gesprächs.
Damals war ihm das natürlich nicht klar, denn: „In den 13 Jahren, in denen ich mit Drogen zu tun hatte, hat das zu Hause niemand gemerkt, weil ich das überspielen konnte. Ich war nicht der typische Junkie sondern der brave Bub, der seine Hausaufgaben, später seine Lehre als Maler und Anstreicher gemacht hat. Ich bin auch in die Kirche gegangen, war Ministrant und in der katholischen Landjugend.“ In die Kirche, so erzählt er, sei er nicht gegangen, weil er an Gott geglaubt habe, sondern: „Wenn ich in die Kirche gehe, glaubt doch keiner, dass ich mit Drogen zu tun habe. Ich habe immer verschiedene Rollen gespielt. Soweit ich darüber nachgedacht habe, meinte ich, es könne einen Gott, der all das in meiner Familie zulässt, gar nicht geben.“
Bald hat Haschisch nicht mehr gereicht. Er wendet sich härteren Drogen zu. Mit 16 wird ihm in einer Disco, zunächst wieder umsonst, der erste LSD Trip angeboten. „Der hat mich von den Socken gehaut. Ich war für sechs Stunden weg: der Boden entschwindet, der Kellner schwebt irgendwie vorbei, viele Farben, viel Lärm – nicht angenehm, aber sechs Stunden Realitätsverlust,“ versucht Bruder Philemon die erste Erfahrung mit LSD in Worte zu fassen. Ein paar Burschen tragen ihn nach Hause, erklären seinen Zustand mit einem Alkoholrausch. Von den Erwachsenen war damals ja niemandem bewusst, wieviele Jugendliche schon mit Drogen zu tun hatten, bedauert er. In wievielen Familien, so frage ich mich, weiß man das auch heute nicht?
Zwischen 14 und 16 nimmt er also immer härtere Sachen, alles außer Heroin. Vor allem der pietätlose Umgang dieser Menschen, den er beobachtet, hält ihn davon ab. So erlebt er, wie ein Bursche, der durch einen „goldenen Schuß“ sein Leben weggeworfen hatte, in einer Toilette in all dem Unrat und Gestank liegend, von den heroinabhängigen Junkies „ausgebanelt“ wird: Alles, was man zu Geld machen kann – Stiefel, Gürtel, Jeans, ein Goldzahn, den man ihm ausschlägt – wird ihm vor Eintreffen der Polizei entwendet.
Heinz selbst bleibt beim Kokain: „Man ist hellwach, kann sich konzentrieren, ist cool drauf…“ Also alles super? „Nein, denn kaum spürt man es nicht mehr, klappt man wie ein Taschenmesser zusammen,“ braucht also schnell eine neue Ladung. 120 DM braucht er täglich für Kokain und zwar unbedingt! Wie kommt man zu soviel Geld? Mit kleinen Einbrüchen z.B. in Trafiken. Oder, indem man alten Omas im Vorbeifahren mit dem Mofa die eben behobene Rente raubt, gesteht mein Gegenüber aufrichtig. „Dass die arme alte Frau jetzt kein Geld hatte, war uns egal. Hauptsache, wir hatten eines.“ Doch schließlich reicht auch das nicht.
Eines Tages rät ihm ein „Kumpel“ zu einer zwar „nicht angenehmen“ dafür sehr einträglichen, nie versiegenden, schnellen Geldquelle: die Prostitution. So landet mein Gegenüber 1977 auf dem Strich von Nürnberg. Weil er so jung ausschaut, ist er bei den „Freiern“ besonders beliebt. Bis zu 300 DM am Tag bringt der Verkauf des Körpers ein. „Um den Ekel, den ich davor hatte, aushalten zu können, war ich immer angekifft oder betrunken. Man sieht, in welchen Teufelskreis einen die Droge bringt: Du brauchst das Geld für die Droge, aber die Droge, um den Ekel zu ertragen.“
Trotz allem beendet er in dieser Zeit Schule und Malerlehre. Danach geht es zur Bundeswehr. Dort ist die Beschaffung von Drogen übrigens auch nicht schwierig. „Dort war es wichtig, dass niemand von der Prostitution wusste, denn sonst wäre ich womöglich vergewaltigt worden,“ fügt er hinzu. Nach der Bundeswehr geht er wieder für einige Jahre in seinen Beruf zurück.
Trotz Prostitution bleibt er daheim der nette, unauffällige Sohn, geht brav in die Kirche mit. Eigentlich ein begabter Schauspieler, der gekonnt mit der Lüge jongliert. Ist er in Geldnot, zieht er abends wieder los. Mit der Zeit kennt man den so jung aussehenden Mann nicht nur in Nürnberg und München. „Männer, die für Geld billigen Sex mit Mädchen oder Jungs wollen, gab es damals wie heute,“ stellt er nüchtern fest.
Was für Männer das waren? Homosexuelle? „Nein, so wenig wie ich. Oft sind das Familienväter, wohl auch mit Kindern in meinem Alter. Die wollten einfach schnellen Sex mit einem jungen Burschen.“ Zu dieser Zeit hat er übrigens eine Freundin, die auf dieselbe Art wie er zu Geld kommt.
Obwohl er nicht an Gott glaubt, zündet er doch immer wieder eine Kerze bei der Muttergottes an. Warum? In der Kapelle hat er Ruhe, wird von niemandem angesprochen. Manchmal kommt der Gedanke: „Jesus, wenn es dich gibt, musst du mir helfen. Alleine finde ich da nicht heraus.“
Mit 23 zieht er von zu Hause aus und macht eine dreijährige Ausbildung mit Fachschulreife als Heilpädagoge und arbeitet dann in einem Internat für lernbehinderte Kinder und Jugendliche. Weg aus dem gewohnten Umfeld, meint er, einen anderen Weg finden zu können. Doch die Droge zieht mit. 2000 DM verdient er nun, doch für den Erhalt von Wagen und Motorrad, die er nun sein Eigen nennt, und für die Finanzierung seines Drogenkonsums reicht das nicht.
Eines Tages, mittlerweile ist er 29, wird ihm so richtig bewusst, in welch verheerender Lage er sich befindet. In der Kirche heult er sich aus: „Jesus, hilf mir raus, ich kann nicht mehr!“ Vier Wochen später merkt er eines Tages: Er hat kein Kokain in der Hosentasche. Katastrophe. So zieht er los, trifft einen Mann, der ihm 300 Mark bietet, wenn er mitgeht. Als dieser dann aber nicht zahlen will, schlägt ihm der Geprellte eine Bierflasche über den Schädel und entwendet ihm 1.000 Mark. Vier Wochen später – er ist zu Besuch bei den Eltern – erscheint die Polizei und nimmt ihn wegen schwerer Körperverletzung fest. Wut, aber auch Erleichterung („Jetzt hat das alles endlich ein Ende“) stellen sich ein. Er landet in einer Zelle. Bald versteht er, warum man ihm Gürtel und Schnürsenkel abgenommen hat: Wie hält man das aus, Selbstmord?
Beim Verhör – er verbringt sieben Monate Untersuchungshaft in einer Mannschaftszelle – gibt er einiges zu. Drogen gibt es auch hier. Sie werden auf verschiedenste Weise eingeschmuggelt, auch von Beamten, deren Familien bedroht werden, falls sie nicht kooperieren.
Um sich irgendwo „festhalten zu können“, bastelt er einen Rosenkranz, merkt, dass er beim Beten ruhiger wird. Körperverletzung und Beschaffungskriminalität sind die Hauptanklagepunkte. Die Prostitution kommt auch zur Sprache, wird aber nie im Gefängnis verbreitet werden. Auch hier würde ihm sonst Vergewaltigung blühen. Das Ergebnis: Vier Jahre Haft. Eine Zeit ohne Freunde bricht an, denn auf niemanden ist Verlass. Jeder ist bereit, andere zu verraten, wenn das Vorteile bringt. Besuch gibt es nur einmal im Monat. Der Vater spricht nie, wirkt eiskalt, die Mutter weint.
„Im Gefängnis kann man entweder so weitermachen wie vorher oder über sein Leben nachdenken,“ stellt mein Gegenüber fest. Heinz macht weiter wie bisher: Beschafft sich weiterhin Drogen. Doch eines Tages sieht er ein Plakat im Gang: Jesus, der Gitterstäbe zerbricht – Einladung der Gefängnismission der Emmausgemeinschaft. „Aha,“ denkt er, „katholische Belehrung. Typisch.“
Immer wieder trifft sein Blick diesen Jesus. Und ist da nicht auch eine Stimme, die sagt: Heinz, geh hin, das wird dir helfen? Zu guter Letzt meldet er sich an – „hilft’s nichts, so schadet’s nichts.“ Außerdem kann er für 1,5 Stunden der Zelle entfliehen.
Eines Abends bringt ihn ein Beamter zum Treffen: Als 12. (!) betritt er den Raum. Bruder Jan Herrmanns (Gründer der Emmausgemeinschaft) geht auf ihn zu und umarmt ihn. „So eine Umarmung habe ich noch nie erlebt,“ erzählt er heute noch sichtlich berührt. „Ich spürte: Das ist Liebe pur.“ Die Männer dort erzählen aus ihrem Leben. Nach ein paar Tagen hat Heinz so großes Vertrauen zu Jan Herrmanns und dessen Mitarbeitern gefasst, dass auch er zu erzählen beginnt.
Am letzten Abend rät Bruder Jan ihm: „Du musst deine Wut und deinen Zorn an Gott abgeben. Du selbst kannst das nicht tragen. Wenn du es aber an Gott abgibst, wird dir leichter ums Herz werden.“ Die Reaktion von Heinz: „Das glaub ich nicht, ich kann das nicht: Wenn ich meine Wut abgebe, kann ich ja auf niemanden mehr zornig sein: nicht auf den Vater, die Freier, auf mich selbst, auf Gott, die anderen. Nein, das wollte ich nicht.“
Bruder Jan betet darauf hin sehr lange über ihn. Und plötzlich: „Jesus, ich gebe dir all meine Wut, meinen Zorn, meinen Hass – so brach es aus mir heraus. Ich kann es nicht mehr tragen. Als zunächst nichts passierte, war ich enttäuscht, bin zurück in meine Einzelzelle. Der Beamte sperrt ab. Und da ist plötzlich ein Licht in der Zelle, ich muss mich auf den Boden werfen. Ein Gefühl der Ohnmacht erfasst mich. Noch einmal habe ich Jesus alles übergeben und spüre wie alle Last von mir fällt. Mein Herz wird für die Liebe frei– eine unbändige Liebe, die Gott für mich hat, die mich auf den Boden geworfen hatte. Ich habe wie ein Wahnsinniger geweint.“
Und dann passiert noch etwas: „Ab diesem Moment habe ich keinen Suchtdruck mehr gehabt. Keine Drogen mehr gebraucht; was ich noch hatte, sofort ins Klo gespült.“ Mancher brauche offenbar so ein Pauluserlebnis, um klar zu sehen, überlegt er.
Der erste, der sich wundert, ist der Beamte, den der Häftling liebenswürdig begrüßt und nach dem Befinden der Familie befragt. Statt fernzusehen, liest Heinz von da an in der Bibel, hört Radio Vatican, bekommt ein Stundenbuch vom Gefängnisseelsorger und betet nun regelmäßig damit.
Heinz, der statt Hass nun Liebe für seine Mitmenschen empfindet, ändert sich: hilft den Mitgefangenen, wo er kann, hört zu, betet mit den Gefangenen, die das wollen. Er ist nun Lektor in der Anstaltskirche, singt im Chor, geht zur Beichte. Mit den Gefangenen, die wie er die Einkehrtage besucht hatten, treffen sie sich nun zu zwölft zum Gebet. Fünf gebastelte Rosenkränze habe er in dieser Zeit verbraucht. „Mein Leben hat sich in diesen zwei Jahren komplett verändert. Das haben die Gefangenen aber auch die Beamten gespürt.“ Zu Weihnachten bastelt er eine große Krippe aus Moos und Holz, die er heute noch hat „Im Gefängnis habe ich die intensivsten Weihnachten erlebt. Ich war allein mit dem Herrn.“
Nach der Entlassung tritt er in die Emmausgemeinschaft ein: Zwei Jahre Postulat, zwei Jahre Noviziat. Für Bruder Herrmanns waren die Menschen, die aus der kriminellen oder Drogenszene kommend sich von Gott berühren lassen und sich aus diesem Milieu lossagen, besonders wertvoll. Sie waren natürlich besonders befähigt, wiederum andere aus der Szene herauszuholen. Genau das macht auch Heinz, der nun zu Bruder Philemon („Der die Liebe bringt“, den Nächsten bei sich aufnimmt wie den Herrn selbst, Phil.17) geworden ist.
Er kehrt an die Plätze, wo er früher war, zurück, kümmert sich um Jugendliche, denen es so geht wie ihm einst. Manche werden in den Häusern der Gemeinschaft untergebracht. „Ich habe gespürt: Das ist jetzt meine Berufung. Gott hat mich dahin zurückgebracht, wo ich herkam mit dem Auftrag, Menschen zu helfen, aus dieser Szene herauszufinden, indem ich meine Geschichte erzähle, meine Erfahrungen einbringe.“
Dass Br. Philemon mit Hunden unterwegs ist, erleichtert den Kontakt: Oft bietet man ihm dann einen Joint an: „Nein danke, ich brauch den nicht mehr, aber du.“ Ja wieso, was meinst du damit? Man kommt ins Gespräch, an dessen Ende bei den Jungen oft die Hoffnung aufkommt, auch den Ausstieg aus Droge und Prostitution zu schaffen.“ Ich kann mir gut vorstellen, dass Jugendliche die Liebe spüren, die Gott Br. Philemon gegeben hat und die er weitergibt.
Dann aber neigt sich das Leben des Gründers der Emmausgemeinschaft dem Ende zu. Nach einem Herzinfarkt wird Bruder Jan von Br. Philemon und dessen Mitbrüdern ein Jahr lang bis zu seinem Tod betreut. „Noch am Sterbebett hat er Menschen miteinander versöhnt. Er war voller Liebe wie Jesus,“ erinnert er sich dankbar an seinen geistigen Vater.
Nach dem Ableben des Gründers löst sich die Gemeinschaft langsam auf, für Br. Philemon ein Grund für Veränderung. So kommt er nach Österreich, tritt der Franziskanischen Gemeinschaft in Pupping bei und begleitet in Neumarkt Pfarrer Josef Gratzer, den er seit Jahren kennt. Er kümmert sich weiterhin um Jugendliche in der Szene, geht in Schulen, Gefängnisse und erzählt offen aus seinem Leben. Dass er das aushält, ist eine große Gnade, denke ich
Sein Hauptanliegen: auf die Hintergründe von Suchterkrankungen aufmerksam zu machen: die Schwierigkeiten in den familiären Beziehungen. „Sie gleichen sich oft wie ein Ei dem anderen: Man kann die Erwartungen des Vaters, der Mutter nicht erfüllen, fühlt sich nicht angenommen, sucht sich einen anderen Kanal außerhalb der Familie.“
In der Pfarre stehen heute immer wieder Leute vor der Tür, die Hilfe brauchen. Eltern rufen an, ob er mit dem Sohn, der Tochter, reden könne. Gerne, doch das Kind muß es auch selbst wollen, meint er dann. Oder die Polizei kommt vorbei und holt Br. Philemon, weil ein Jugendlicher seinen Beistand braucht. „Ich bin gern für die Leute da. Manche Jugendliche bitten mich, bei einer Vernehmung dabei zu sein oder bei einer Verhandlung.“ Schön ist es, wenn es sichtbare Erfolge gibt: ein Jugendlicher, der nach Medjugorje mitfährt und sein Leben komplett ändert. Oder der Anruf einer Mutter: Der Bub, der solche Sorgen gemacht hatte, hat die Schule erfolgreich beendet!Ein Vater meldet sich: „Was haben Sie mit meinem Buben gemacht? Der hat sich ja total positiv verändert.“ Oder noch: Eine junge Frau ruft an, sie habe Medizin fertig studiert. Vor Jahren habe er ihr so geholfen, dass sie diesen Schritt gewagt habe. Nun möchte sie ihm ihren ersten Gehalt geben – für seine Arbeit.
Bei allen Begegnungen, ob in Schulstunden oder auf der Straße, hinterlässt er seine Telefonnummer mit dem Versprechen: Man dürfe ihn immer kontaktieren. Drei Jugendliche, denen er die Nummer gegeben hatte, rufen ihn ein Jahr später in der Nacht an, als sie in Schwierigkeiten sind, und er hilft. „Aber man muss Gott arbeiten lassen. In Berlin hatte ich mir vorgenommen, abends am Bahnhof Jugendliche aus der Szene herauszuholen. Aber es hat nicht funktioniert. Als ich dann am Tag darauf Gott alles überlassen habe (‚Jesus, wenn du willst“), sind Süchtige auf mich zugekommen.“
Das kann natürlich auch gefährlich werden, denn Zuhälter sehen nicht gerne, wenn man ihnen ins Geschäft pfuscht. „Einmal, als wir in Hamburg einen15-Jährigen im Auto mitnahmen, haben uns Zuhälter mit einem Mercedes verfolgt. Die Brüder haben intensiv Rosenkranz gebetet. Beim letzten Gesätzchen ein Knall. Der Mercedes hatte einen Reifenplatzer!“
Mit seinem Vater konnte er sich versöhnen: Eines Tages ruft ihn die Mutter an, der Vater liege im Sterben. Br. Philemon eilt heim. Da redet der Vater endlich mit ihm. Vater und Sohn bitten einander um Vergebung und versöhnen sich. Zwei Stunden später stirbt der Vater. Für Br. Philemon ein Zeichen Gottes.
Hat er sich nie gefragt, warum Gott nicht früher schon eingegriffen hat? „Ich glaube, ich musste im Gefängnis landen. Ich hätte mich sonst nicht verändert. Diese vier Jahre waren ein Segen.“ Gott benutze oft Lebenssituationen, die uns gar nicht gefallen. Denn dann sind wir für Sein barmherziges, gnadenvolles Eingreifen empfangsbereiter, meint mein Gesprächspartner und lächelt.
 Überraschender Wintereinbruch! Ausgerechnet jetzt, da wir nach Oberösterreich unterwegs sind, um in der Pfarre Neumarkt am Hausruck Bruder Philemon Kleinöder zu treffen. „Zufällig“ hatte ich in Radio Maria einen Teil einer von ihm gestalteten Sendung gehört: Er sagte gerade ungefähr Folgendes: „Am schönsten war Weihnachten im Gefängnis. Da war ich ganz allein mit dem Herrn.“ Ich fand das überraschend aus dem Mund eines Ordensbruders. So habe ich mich auf die Suche nach ihm gemacht. In Neumarkt habe ich ihn dann getroffen und mich schon auf die Begegnung mit diesem Mann gefreut. Es gehört zu seiner Mission, aus seinem Leben zu erzählen, um Jugendliche davor zu bewahren, in dieselben Fallen zu tappen wie er. Mit seiner so sympathischen, wohlklingenden Stimme erzählt er dann.
Überraschender Wintereinbruch! Ausgerechnet jetzt, da wir nach Oberösterreich unterwegs sind, um in der Pfarre Neumarkt am Hausruck Bruder Philemon Kleinöder zu treffen. „Zufällig“ hatte ich in Radio Maria einen Teil einer von ihm gestalteten Sendung gehört: Er sagte gerade ungefähr Folgendes: „Am schönsten war Weihnachten im Gefängnis. Da war ich ganz allein mit dem Herrn.“ Ich fand das überraschend aus dem Mund eines Ordensbruders. So habe ich mich auf die Suche nach ihm gemacht. In Neumarkt habe ich ihn dann getroffen und mich schon auf die Begegnung mit diesem Mann gefreut. Es gehört zu seiner Mission, aus seinem Leben zu erzählen, um Jugendliche davor zu bewahren, in dieselben Fallen zu tappen wie er. Mit seiner so sympathischen, wohlklingenden Stimme erzählt er dann.