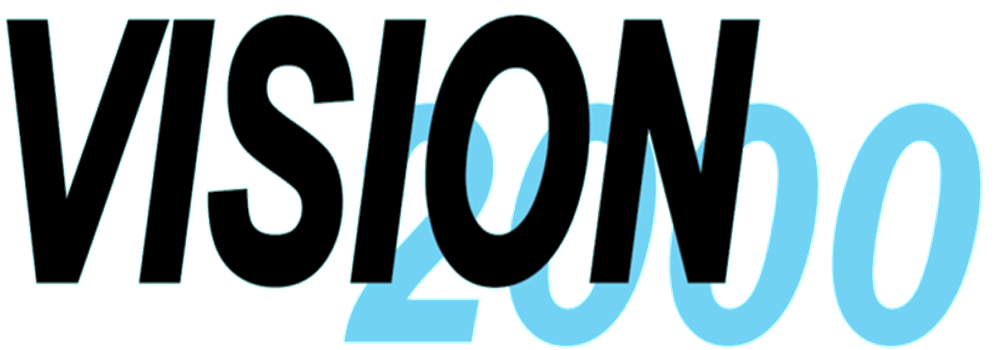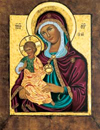Männer - welches Bild haben wir da vor Augen, wenn wir vom modernen Mann sprechen? Was tritt da vor das Auge des nach Orientierung suchenden jungen Mannes? Welches Bild präsentieren uns die Medien?
In den Nachrichten etwa zeigt man uns den erfolgreichen Manager, gut gekleidet, cool, weltgewandt, mit Überblick, Herrscher über Millionenbeträge. In der Sportsendung den Kraftprotz oder den wieselflinken Läufer, den Kämpfer mit verzerrtem Gesicht und geballter Faust nach erfolgreichem Torschuß, den jugendlichen Star, dem die Mädchenherzen zufliegen. Oder den Politiker, über alles informiert, überlegen und aalglatt im Interview, polternd, wenn es die Rolle verlangt - und unausgesetzt in seiner Autorität von alles noch besser wissenden Journalisten infrage gestellt.
Dazu kommen die Bilder aus Film und Werbung: der Kraftlackel, der durchtriebene Verbrecher, der von einer Unzahl von Gütern beglückte Konsument, der Frauen verschleißende Held, der gefühlsbetonte Homosexuelle, der schürzenbekleidete Softie daheim,oder der sich in grotesken Verrenkungen und absurden Verkleidungen darbietende Rockstar, dem die Mädchenwelt zu Füßen liegt...
Für eine wachsende Zahl von Knaben und Burschen sind das die Vorbilder. Denn sie haben zu Hause den Vater gar nicht oder nur kurz erlebt. Man bedenke, daß allein in Österreich jährlich rund 22.000 Kinder den Vater durch Scheidung mehr oder weniger vermissen müssen, daß jede dritte Geburt unehelich ist, was die Wahrscheinlichkeit des Auseinandergehens der Eltern enorm erhöht. Fast immer entfallen dann die Alltagserfahrungen, das zwanglose Zusammensein mit dem Vater, die übrigens auch viele Kinder bei aufrechter Ehe entbehren müssen, wenn sich Männer im Beruf verschleißen und zu ihrer Regeneration in der Freizeit außerhäuslich betätigen: in Vereinen oder beim Sport.
Nun ist aber gerade die Väterlichkeit das wichtigste Merkmal der Männlichkeit. Sie kommt erst in der persönlichen Begegnung voll zum Tragen. Denn in der Berufswelt, wo es um die Erledigung von Aufgaben geht, macht es keinen großen Unterschied, ob da ein Mann oder eine Frau am Werk ist. In der Vorstandsetage, an der Billa-Kassa, im Führerstand der Lokomotive, in der Schule oder im Krankenhaus färben die besonderen Begabungen der Geschlechter zwar die Art der Aufgabenerfüllung, sie sind aber für das Erbringen der Leistung meist nicht wesentlich. Das wird heute nur allzu deutlich, da viele Frauen am Arbeitplatz “ihren Mann stellen".
Wirklich unersetzbar aber ist der Mann in der Familie. Das entdeckt mittlerweile auch die Forschung, die Jahrzehnte hindurch von der Ideologie der Gleichheit der Geschlechter geprägt war. Die Vaterlosigkeit hat die nachwachsende Generation unübersehbar geschädigt. In einer Untersuchung aus Oberösterreich heißt es beispielsweise: “Die familiäre Verweigerung des Vaters kann heute als einer der bedeutsamsten Faktoren, der die gesunde Entwicklung des Kindes gefährdet, angesehen werden."
Dieser Befund kann gar nicht ernst genug genommen werden. Gerade wir Männer, denen das zielgerichtete Tun, das Schaffen, das Zweckhafte, das Funktionale, das außerhäusliche Wirken so wichtig erscheint, müssen uns die Frage gefallen lassen: Für wen geschieht denn das alles? Nur zur eigenen Selbstbestätigung? Bekommt dieses Tun nicht erst wirklich Sinn, wenn es im Dienst für andere geschieht - insbesondere für die nächste Generation, die eigenen Kinder? Was nützt es, eine Welt von Wolkenkratzern, Luxusautos, Shopping Citys, Forschungslabors zu schaffen, wenn in diese Luxusgebilde lauter in der Kindheit ruinierte menschliche Wracks einziehen?
Der Engpaß einer gedeihlichen Entwicklung unserer Gesellschaft liegt in der Familie - und dort vor allem beim mangelnden Engagement der Väter. Eine Renaissance der Väterlichkeit ist überfällig - sie ist allerdings schon in vielen christlichen Familien zu beobachten, Gott sei Dank!
Was haben nun aber die Väter einzubringen? Zunächst einmal sind sie in einer besonderen Weise herausgefordert, den Bestand der Familie zu garantieren. “Darum verläßt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch" (Gen 2,24), heißt es am Anfang der Heiligen Schrift. Der Mann hat zu verlassen, was im wichtig war: Eltern, Hobbys, Freunde, Job... Er muß erwachsen, entscheidungsfähig werden - so entscheidungsfähig, daß er sich lebenslang zu binden vermag, unwiderruflich im Vertrauen auf das Wirken Gottes. Natürlich wird er weiterhin mit Freunden und Eltern verkehren, einen Job ausüben und Hobbys betreiben, aber unter dem Aspekt, daß von nun an seine Ehe Vorrang hat, damit eine neue Einheit, die Familie entstehen kann. Sich zu binden, ist eine Grunddimension der Männlichkeit, der männlichen Liebe.
Wo Knaben das lernen können? An ihren Vätern selbstverständlich! Indem die Kinder mitbekommen, daß da einer ist, der sich ihnen aus freien Stücken zuwendet, anders als die Mutter, zu der die Intimität viel selbstverständlicher gegeben ist: Sie hat das Kind unter dem Herzen getragen und an der Brust gestillt. Sie ist der erste Lebensraum des Kindes. Im Vergleich dazu ist der Vater ein Außenstehender. Diese Tatsache färbt auf seine Zuwendung zum Kind ab. Die aber wird zur lebenswichtigen Zugabe, die es dem Kind ermöglicht, schrittweise aus der Symbiose mit der Mutter herauszuwachsen, den Wert der eigenen Persönlichkeit zu entdecken.
Das gelingt, wenn Kinder die Erfahrung machen: Ich bin dem Vater wichtig. Er sagt aus freien Stücken zu mir ja, anders als die Mutter. Er hat sich an sie gebunden, er bindet sich auch an mich. Er steht zu mir, was immer geschehen mag. Diese Erfahrung, unbedingt, aus freien Stücken gewollt zu sein, ist lebensnotwendig. Sie baut auf gemeinsamen Erlebnissen mit dem Vater auf. Je mehr sich das Kind nach außen, ins fremde Umfeld wagt, umso mehr ist der Vater gefordert.
Damit sind wir bei einer seiner wichtigsten Aufgaben: den Kindern Wege in die Gesellschaft zu weisen, sie zu Schritten aus der Geborgenheit zu animieren und sie dabei zu begleiten. Je älter die Kinder werden, umso wichtiger wird diese Brückenbaufunktion des Vaters nach außen. Das erfordert Zeit für Gespräche, die Bereitschaft, sich herausfordern zu lassen, die väterlichen Ratschläge, Gebote und Verbote auch zu begründen - keine leichte Aufgabe. Wenn es gilt, die Einhaltung von Spielregeln einzumahnen, ist Autorität gefragt. Jetzt trägt das in der Kindheit aufgebaute Vertrauen Früchte.
Mit Grenzen umgehen zu lernen, ist ein weiterer wichtiger Dienst, den Väter ihren Kindern leisten dürfen. In zweifacher Hinsicht ist das für ihre Persönlichkeitsentwicklung wichtig: Einerseits muß der junge Mensch lernen, Grenzen zu überwinden, Anstrengungen um eines höheren Anliegens willen auf sich zu nehmen, mit Mühsal zurechtzukommen. Dazu müssen Väter schrittweise vernünftige, erreichbare Ziele setzen. Wichtig: Erfolge sind zu feiern, Mißerfolge nicht zu dramatisieren.
Andererseits muß jeder lernen, mit Grenzen zu leben, auch wenn der jugendliche Optimismus dagegen rebelliert. Gerade in einer Zeit, in der uns die Medien eine Traumwelt, in der alles möglich scheint, ins Haus liefern, muß der Heranwachsende begreifen, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Vielfach wird heute diese Aufgabe zum Nachteil der jungen Leute vernachlässigt. Ich erinnere mich an meine Erfahrungen als Bewährungshelfer: Fast alle unserer damaligen Klienten, kriminell gewordene Männer, waren vaterlos aufgewachsen, hatten nie gelernt, sich mit Grenzen abzufinden.
Wer jedoch mit Grenzen umzugehen lernt und so langsam zur eigenständigen Persönlichkeit heranwächst, die sich Ziele zu stecken, aber auch mit Unveränderbarem abzufinden vermag, macht die Erfahrung, daß Leiden zum menschlichem Wachstum gehört. Seinen Kindern diesen Lernprozeß zuzumuten, fällt dem Vater leichter als der Mutter, jedoch nur, wenn er rechtzeitig das Vertrauen der Kinder gewonnen hat.
Der kanadische Psychotherapeut Guy Corneau (siehe Seite 6) stellt diesbezüglich ein Versagen der Väter fest: “Heute wird der Sinn des Leidens von den Vätern nicht mehr erschlossen und weitergegeben. Vom Wunsch nach Bequemlichkeit besessen, versuchen sie ihm, so gut es geht, zu entkommen. Wo aber die Väter das Leid nicht mehr ertragen und daher der Sinn dafür verloren geht, dort erleben wir das traurige Schauspiel einer Generation von Jugendlichen, die, mit dem Grauen in der Welt konfrontiert, in den Selbstmord flüchten."
Der Umgang mit Grenzen und Leid: Hier stoßen wir an Tabus unserer Zeit, die sich sowohl der Grenzen- wie der Leidlosigkeit verschrieben, die Menschen damit aber nicht glücklich gemacht hat, wie schon ein flüchtiger Blick in die Statistik der Fehlverhalten zeigt. Die Renaissance der Väterlichkeit wird sich an diesen Punkten bewähren müssen. Sie setzt Männer voraus, die ihren Kindern nicht ideologisch geprägte Vorschriften zumuten, sondern ihren Kindern vorleben, daß ein gelassener Umgang mit den Lebensumständen innerlich frei werden läßt.
Der väterliche Mann ist somit einer, der sich um innere Stabilität bemüht, damit seine Umgebung bei ihm Sorgen und Ängste, Kummer und Verzagtheit, Mißmut und Niedergeschlagenheit abladen kann, der Mut zuspricht, in Notsituationen Rückhalt gibt und bei Versagen wieder aufbaut.
All das macht deutlich, daß Väter in unserer Zeit der beruflichen Überforderung, der medialen Irreführung, der Benachteiligung der Familie überfordert sind. Wer auch nur halbwegs dieser Aufgabe gerecht werden will, wird sich wohl für das Wirken des Heiligen Geistes offen halten müssen. Die Zukunft gehört somit den betenden Vätern. Von dieser Spezies gibt es, Gott sei Dank, immer mehr Exemplare - vor allem auch unter unseren Lesern. Ein Grund zur Hoffnung.