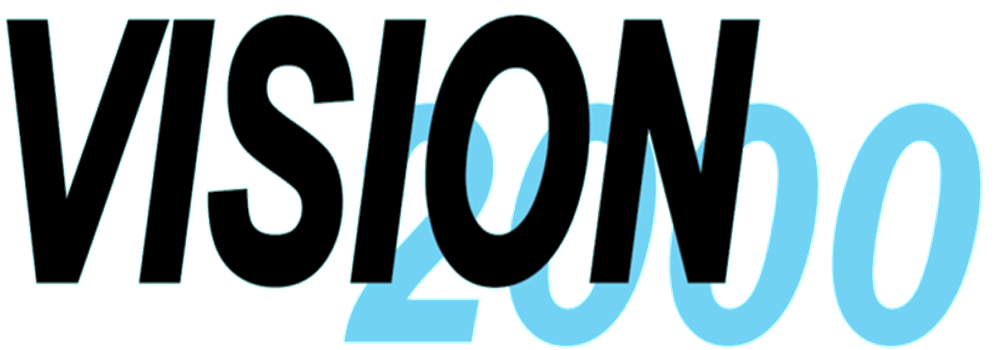Getroffen haben wir uns in der Nähe von Kopfing, einem malerischen Ort in Oberösterreich. Abby Johnson, Ex-Direktorin einer Abtreibungsklinik in Texas, war eingeladen worden, über ihre Erfahrungen mit der größten Abtreibungsorganisation der USA, Planned Parenthood, sowie über ihre Bekehrung zur engagierten Lebensbefürworterin zu erzählen. Bei köstlicher Mehlspeise – Abby war seit dem Vortag kaum zum Essen gekommen – beginnt sie, mir nüchtern und sehr ehrlich, aus ihrem Leben zu erzählen.
Getroffen haben wir uns in der Nähe von Kopfing, einem malerischen Ort in Oberösterreich. Abby Johnson, Ex-Direktorin einer Abtreibungsklinik in Texas, war eingeladen worden, über ihre Erfahrungen mit der größten Abtreibungsorganisation der USA, Planned Parenthood, sowie über ihre Bekehrung zur engagierten Lebensbefürworterin zu erzählen. Bei köstlicher Mehlspeise – Abby war seit dem Vortag kaum zum Essen gekommen – beginnt sie, mir nüchtern und sehr ehrlich, aus ihrem Leben zu erzählen.
Geburt 1980 in Texas. Die Eltern, Mitglieder einer kleinen protestantischen Gemeinde, gehen jeden Sonntag in die Kirche. Mit 8 Jahren wird Abby getauft. Ihre Kindheit, die sie in sehr schöner Erinnerung hat, verbringt sie hauptsächlich in Louisiana, wohin die Eltern gezogen waren. Sie ist eine gute Schülerin, engagiert sich in Schulaktivitäten und in der kirchlichen Jugendgruppe. Sie sei sehr konservativ erzogen worden, sagt sie. Christliche Werte, etwa bezüglich vorehelichem Sex, habe sie zwar verinnerlicht, aber leider nicht umgesetzt, wie sie heute bedauernd feststellt.
Als Studentin verliebt sie sich im Jahr 2000 Hals über Kopf in Mark. Es dauert nicht lange, und sie stellt fest, dass sie schwanger ist. Kein Problem für den jungen Mann, der bereits einen dreijährigen Sohn aus einer früheren Beziehung hat: Er schlägt Abby eine Abtreibung vor – und sie stimmt zu! 500 Dollar kostet das „Entfernen der Schwangerschaft“. Kein Bedauern! Abby ist froh, als die Prozedur vorbei ist und dass sie nach ein paar Tagen wieder auf die Uni gehen kann – als wäre nichts gewesen! Dass sie ein Baby mit einem Recht auf Leben in ihrem Leib getragen hatte, war ihr nicht in den Sinn gekommen, bemerkt sie mit Schaudern. Sie hatte ja nur eine „Schwangerschaft“ „behandeln“ lassen. Wie kann doch die Sprache dazu verführen, sich selbst zu belügen!
Über das beseitigte „Problem“ spricht sie jedenfalls weder mit Freunden noch mit ihrer Familie.
Rückblickend sieht sie sich als leichtgläubiges, naives Mädchen, das leicht zu manipulieren und zu beeindrucken war. Daher lässt sie sich auch ein Jahr später als Psychologiestudentin im Rahmen einer Veranstaltung an der Universität von einer gutaussehenden, wortgewandten Frau, die Dienstleistungen von Planned Parenthood (PP) für Frauen in Krisensituationen anpreist, schnell überzeugen, dort mitzuarbeiten. Die Sicherheit von Frauen und ihre Rechte auf gute medizinische Versorgung (auch so kann man ja Abtreibung umschreiben) zu gewährleisten, ist für Abby, die viel Mitgefühl besitzt und hilfsbereit ist, eine gute Sache. PP tue auch alles, um die Zahl der Abtreibungen zu verringern, hört sie.
So beginnt sie also bei einer der bekanntesten Organisationen der USA zu arbeiten: Nicht nur auf Abby wirkt der verheißungsvolle Name (Planned Parenthood – Elternschaft nach Plan) wie das verlockende Knusperhäuschen auf Hänsel und Gretl (Ein Vergleich, den die zu früh verstorbene Abtreibungsgegnerin Karin Struck im Hinblick auf den deutschen PP-Zweig „Pro Familia“ verwendet hat). Hänsel und Gretl haben allerdings rechtzeitig ihren beinahe fatalen Irrtum bemerkt.
Den abtreibungswilligen Frauen in Texas geht es da nicht so gut: Abbys Aufgabe besteht nämlich nun darin, Frauen, die zur Abtreibung kommen, in das Knusperhäuschen (die PP-Klinik) zu eskortieren. Sie soll verhindern, dass die Klientinnen von Pro Life-Aktivisten, die vor der Klinik stehen und beten, angesprochen oder gar aufgehalten werden. Etwas verwirrt fragt sie sich da schon, warum sie Frauen, die doch ihre eigenen Entscheidungen treffen sollen (Pro choice!), davor beschützen soll, mit jemandem über diese Entscheidung zu sprechen.
„Ich wusste damals einfach nicht, dass PP die bedeutendste Abtreibungsbefürworterin der USA ist. Alles, was ich gehört hatte, war, dass PP den Frauen aus ärmlichen Verhältnissen hilft und sich um deren Gesundheit bemüht. Ich fand, das sei eine gute Sache.“ Klar und schonungslos gegen sich selbst fährt sie fort: „Ich habe mir nicht viel bei diesen Abtreibungen überlegt. Es war ja legal, und es schien, als ob Frauen das Recht hätten, darauf zurück zu greifen. Wir verhalfen den Frauen eben zu diesem Recht. Ich dachte, wir würden ihnen da etwas Gutes tun. Über die ungeborenen Kinder dachte ich nicht viel nach. Die Rechte der Frauen wurden viel höher bewertet als deren Rechte. Wir sollten uns keine Sorgen um die Babys – sie wurden ja nie als solche bezeichnet – machen, so hieß es immer. Wichtig waren die Frauen und ihr Recht, über ihr Leben und das ihrer Kinder zu entscheiden.“ Diese Sichtweise kam wohl ihrer Vorgeschichte und den verdrängten Schuldgefühlen sehr entgegen.
In der Bryan-Klinik, für die sie arbeitete, wurden zunächst nur samstags chirurgische Abtreibungen durchgeführt. An den übrigen Tagen konnten Frauen gynäkologische Beratungen, Behandlungen und Untersuchungen in Anspruch nehmen. Von Mark – sie hatte ihn ein Jahr nach der Abtreibung geheiratet – will sie sich scheiden lassen, denn Treue und Liebe haben keinen Platz in seinem Vokabular. Noch vor der Scheidung ist sie jedoch wieder schwanger. Da ihr Mann kein Interesse an Kindern hat, endet auch die zweite Schwangerschaft mit einer Abtreibung.
Wieder fühlt sie sich nicht als Mutter, diesmal eines zweiten (!) Kindes! Heute kann sie überhaupt nicht verstehen, wieso ihr nicht bewusst war, dass sie schon ein Kind unter dem Herzen trug und nicht nur ‘möglicherweise erst eines bekommen’ könnte (wie es oft heißt!). Da in der Klinik täglich die Abtreibungspille RU 486 verabreicht wird und sie erst in der achten Schwangerschaftswoche ist, entscheidet sich Abby diesmal für diese nicht chirurgische „Schwangerschaftsbeseitigung“, wie das in der Organisation genannt wird. Der „ Erfolg“ ist, dass sie tagelang Höllenqualen leidet, starke Blutungen, Krämpfe und hohes Fieber hat. Erst nach zwei Wochen kehrt sie, ohne Baby, an ihren Arbeitsplatz zurück.
Nach der Scheidung trifft sie sich nun häufiger mit Doug Johnson, einem humorvollen jungen Mann, der Sonderschullehrer werden möchte. Mit ihm versteht sie sich gut und bewundert an ihm vor allem, wie sehr der Glaube sein Leben und seine Entscheidungen beeinflusst. Er ist Pro Life und verwickelt sie immer wieder in Diskussionen.
Doch Abby lässt nicht mit sich handeln: Auch wenn Doug behauptet, es gebe keinen entscheidenden Unterschied zwischen einem wenige Tage alten Embryo und einem sieben Monate alten Baby vor der Geburt, ist für sie die Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes der entscheidende Maßstab. Bis dahin sei Abtreibung gerechtfertigt. Es hätte ihr damals an Vernunft und an Logik gemangelt, stellt sie nun sachlich fest. Heute ist sie sicher, dass Gott schon damals durch Doug mit ihr gesprochen habe, nur habe sie auf Seine Stimme nicht hören wollen. Auch durch die friedlichen Beter auf der anderen Seite des Zauns, der die Klinik von der Straße trennt, versucht Gott, sie anzusprechen. Abby reagiert auf diese Leute zwar freundlich, sieht in ihnen aber nur Menschen, die den Frauen ihr Recht auf medizinische Hilfe verweigern wollen.
Bald steigt sie auf der Karriereleiter weiter nach oben, wird Assistentin in der Klinik. Doug macht ihr im selben Monat einen Heiratsantrag und sie nimmt ihn an. Nach ihrem Abschluss in Psychologie übersiedeln beide nach Huntsville, wo Abby weiterstudiert und im dortigen PP-Zentrum arbeitet. Es dauert nicht lange und Abby ist wieder schwanger. Über dieses dritte Kind herrscht große Freude in der Familie – die allerdings nichts von den zwei ersten weiß. Grace kommt zur Welt und Abby kann acht Wochen im Mutterschutz bleiben. Danach wird ein Kindermädchen eingestellt.
2007 wird ihr die Leitung der Bryan-Klinik angeboten. Große Freude! Die Familie ist weniger begeistert, denn nun trägt Abby die Verantwortung für alle Abtreibungen. Heute fühlt sie sich für 20.000 tote Kinder schuldig!
Gott lässt nichts unversucht, wie sie später erkennen wird, um sie zur Wahrheit zu führen. Da gibt es etwa den Tag, an dem eine junge Nonne angesichts einer Mutter, die, völlig niedergeschlagen, nach einer Abtreibung zum Wagen geführt wird, zu weinen beginnt. Abby erkennt deren echten Schmerz und beginnt sich zu fragen, wie viele Leute wohl wegen des Geschehens in ihrer Klinik weinen. Auch die Verzweiflung einer Großmutter – sie versucht vergebens, ihre Enkelin vom Gang in die Klinik abzuhalten – erschüttert sie. Beeindruckt ist sie auch von der Kampagne „40 Tage für das Leben“. Da beten „Pro-Lifer“ bei Tag und Nacht vor der Klinik.
Johnsons sind mittlerweile in die Episkopal-Kirche, die sich – obwohl christlich – Pro Choice, also zur Abtreibung bekennt, eingetreten.
Nun gerät die Organisation aber mehr und mehr in die roten Zahlen. Mitarbeiter werden entlassen, eine große Abtreibungsklinik wird geplant, um das Budgetloch zu stopfen. Intern erfährt Abby, dass hier künftig auch Spätabtreibungen, nach der 21. Schwangerschaftswoche, durchgeführt werden sollen. Sie selbst solle in ihrer Klinik daür sorgen, dass doppelt so viele Abtreibungen durchgeführt werden wie bisher, um das Ergebnis zu verbessern. Für beides hat Abby eigentlich kein Verständnis. „Bis dahin hatten wir nur samstags Abtreibungen durchgeführt. Nun sollten sie jeden Tag stattfinden. Wieso? Angeblich wollten wir die Zahl der Abtreibungen verringern , wie PP der Öffentlichkeit immer verspricht?“
Die Antwort der Vorgesetzten ist eindeutig. „Natürlich wollen wir nicht wirklich Abtreibungen verhindern. Das ist es doch, womit wir unser Geld machen.“ Da sie damit nicht einverstanden ist, bekommt sie eine Rüge.
Einen Monat später kommt ein neuer Abtreibungsarzt in die Klinik: „Er hatte eine eigene Praxis und erklärte, er würde Abtreibungen, anders als wir, mit Ultraschallüberwachung durchführen. Bei uns geschah das ,blind’, was mitunter zu schweren Verletzungen der Gebärmutter geführt hat. Der Arzt erklärte, mittels Ultraschall sei der Eingriff sicherer für die Mutter, da man den Vorgang genau beobachten könne. Ich fragte daraufhin meine Regionalvorgesetzte, warum nicht auch wir das standardmäßig verwendeten. Ihre Antwort: Das würde jede Abtreibung um mehr als fünf Minuten verlängern. Und da wir an Abtreibungstagen 30 bis 40 Abtreibungen durchzuführen hätten – Höchstdauer 5 Minuten –, sei das ein Ding der Unmöglichkeit.“
Abby ist konsterniert. Restlos geöffnet werden ihr die Augen jedoch erst an dem Tag, an dem sie der Abtreibungsarzt einlädt, ihm bei einer Ultraschall-Abtreibung zu assistieren. „Das Baby war 13 Wochen alt. Da ist alles schon entwickelt: Arme, Beine, Herzschlag, Gehirnströme, innere Organe,“ erzählt sie. „Als ich es so voll entwickelt sah, wurde ich leicht nervös und fragte mich, was ich zu sehen bekommen würde. Als die Kanüle des Sauggerätes für die Abtreibung in den Uterus eingeführt wurde und dem Baby nahe kam, sah ich, wie es mit den Armen und Beinen zu rudern begann, um dem Gerät zu entkommen. Es drehte und wand sich heftig. Nie hätte ich gedacht, dass ein so winziges Baby schon so reagieren könnte, um dem Gerät auszuweichen. Schockierend! Dann wurde der Sauger angestellt. Ich sah das Baby um sein Leben kämpfen. Es wurde herumgewirbelt und zusammengedrückt, im Leib seiner Mutter in Teile zerrissen und in die Kanüle gezogen. Schrecklich. Nachdem ich das gesehen hatte, hat sich mein Herz verändert. Man hatte mich belogen: Der Fötus empfinde nichts, verspüre keinen Schmerz, hatte ich brav meinen Patientinnen immer versichert.“ Nun war Abby vom Gegenteil überzeugt worden. „Da war ein vollwertiger Mensch, der Schutz verdient.“
Wieso sei ihr all das erst damals klar geworden, wird sie meist gefragt. Sie habe doch vorher schon bei Abtreibungen - wenn auch ohne Ultraschall - assistiert. Auf diese Frage antwortet sie stets mit einem wiederholten: „Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht….“
Klar sieht sie aber Folgendes: „Bei einer Abtreibung öffnet man sich, wenn auch unbewusst, für das Böse. Und das Böse macht die Menschen buchstäblich blind, immun gegen Wahrheit. Wiederholte, vorgefasste Überzeugungen tun ein Übriges: der Fötus sei kein Mensch, Abtreibung befreie Frauen in Not… Die Sünde macht blind. Hier spielt sich ein spiritueller Kampf ab,“ erklärt sie.
An diesem Tag hatte Gott sie bei der Hand genommen und von der Blindheit befreit: „Ich wusste: Jetzt muss sich radikal etwas ändern. Gott hatte mich gerufen.“ Ihr Entschluss ist gefasst: „Das war’s, ich will da raus. Ich kann das nicht mehr länger machen.“
Allerdings steht sie jetzt vor der Frage: Wie soll es weitergehen? „Ich erinnerte mich an die Leute vor der Klinik, die Pro-Life-Gebetsgruppe. Sie beteten, hatten Rosenkränze und Bibeln, hatten mir stets angeboten, sie würden mir helfen, da rauszukommen, falls ich meine Meinung ändern sollte. So ging ich zu ihnen und erzählte unter Tränen meine Geschichte. Schuld, Schmerz, Reue, Scham hatten mich überwältigt. Ich wusste nun, dass ich auf der falschen Seite des Zauns gewesen war, wenn es darum ging, den Frauen zu helfen. Die Leute beteten für mich, und ich spürte: Gott ist gegenwärtig. Sie boten sofort an, für mich einen Job zu suchen.“
Kurz darauf kündigt Abby. Auf Anraten ihrer neuen Freunde zieht sie sich für einige Wochen in Stille und Gebet zurück, liest in der Bibel, genießt die neue Gemeinschaft mit Gott. Sehr bald findet sie Arbeit bei einem Pro-Life-Gynäkologen.
Als PP herausfindet, dass sie Kontakt zur Pro-Life-Gruppe aufgenommen hat, versucht man sie mundtot zu machen. Eine Klage wird ihr vom Gericht zugestellt. Sie wird bezichtigt, Patientenakten und geschäftsinterne Informationen heimlich entwendet zu haben, um sie zu veröffentlichen. Eine einstweilige Verfügung – einen Maulkorberlass – soll verhindern, dass sie sich öffentlich äußert. „Eigentlich hatte ich nicht die Absicht gehabt, mit meiner Geschichte in die Medien zu gehen. Akten hatte ich auch nicht mitgenommen,“ erzählt sie mir. „PP hatte jedoch eine Presseaussendung gemacht und daher kontaktierten mich die Medien. So wurde meine Geschichte publik. Denn PP ist eine bekannte und vor allem angesehene Organisation, von der die meisten meinen, sie tue Gutes für die Frauen. Verlässt nun jemand diese Organisation und tritt gegen sie auf, ist das eine große Sache. So begann ich auch, auf Pro-Life-Veranstaltungen mein Zeugnis zu geben.“
Und der Prozess? „Man kann niemanden dafür verurteilen, dass er seine Meinung ändert, Pro Life wird und daher nicht mehr für eine Einrichtung arbeiten möchte, die Abtreibungen durchführt. Außerdem haben wir in den USA das Recht auf freie Rede. Daher wurde die Klage abgewiesen.“
Dann geschah etwas merkwürdiges: Die Johnsons wurden aus der – christlichen (?) – Epikopalkirche wegen ihrer öffentlichen Ablehnung der Abtreibung hinausgeworfen! „Daher gingen wir eines Tages in eine katholische Kirche und wohnten einer Messe bei. Das hat uns so beeindruckt, dass wir katholische Einführungskurse für Erwachsene („Christian initiation for adults“) besucht haben – einfach um mehr über die katholische Kirche, ihren Glauben und ihre Geschichte zu erfahren. Wir stellten fest: Bisher hatte man uns immer unwahre Dinge über die katholische Kirche erzählt. Nun aber wurden uns die Augen geöffnet. Je mehr wir hörten, je mehr wir über die Geschichte, die Schreiben der Päpste erfuhren und lasen, desto natürlicher, klarer, ja logisch und folgerichtig erschien uns der katholische Glaube. Wir waren jetzt sicher, dass dies der richtige Platz für uns sei.“ Lachend meint sie: „Wenn man all das weiß – wie kann man überhaupt was anderes als katholisch sein? Das ist doch nur logisch!“ 2012 treten sie und ihr Mann in die katholische Kirche ein.
Die Medienauftritte, die dem Prozess folgen, lösen eine Flut an Briefen und Anrufen aus: Abby wird um Rat nach Abtreibung gebeten, es wird ihr für ihr Zeugnis gedankt, Frauen berichten, dass sie nun doch nicht abtreiben würden… Mittlerweile spricht sie in Schulen und Universitäten, in Schwangerenberatungsstellen, bei verschiedenen Tagungen und Versammlungen, bei Kundgebungen. Sie war in England, Neuseeland, Australien, Kanada, Mexiko und Deutschland, um die Kultur des Lebens zu verteidigen.
„Ich bin Lobbyist und ermutige die Leute, zu ihrem Kongressabgeordneten zu gehen und sich in deren Büro auch an die Mitarbeiter zu wenden. Das ist bei uns mittlerweile normal.“ Mit Protestgruppen und Anfeindungen kann sie gut umgehen: „Das ist okay,“ meint sie ganz ruhig. „Fast immer sind das Leute, die auf die eine oder andere Art mit Abtreibungen zu tun hatten. Mit ihrem Protest versuchen sie, vor sich selbst zu rechtfertigen, was sie getan haben, und sich von Schuld freizusprechen. Ich verstehe das, habe es ja selbst gelebt.“
Sie und ihre Mitarbeiter betreiben jetzt einen apostolischen Hilfsdienst für Mitarbeiter in Abtreibungskliniken, kontaktieren sie und lassen sie wissen, dass es Hilfe für sie gibt, sollten sie ihre Arbeit dort beenden wollen. Allein im vergangenen Jahr haben 154 Menschen ihren Abtreibungsjob aufgegeben und sind in die Pro-Life-Bewegung eingetreten. „Wenn sich solche Menschen bekehren, die Seite wechseln, dann wollen sie auch bezeugen, was Abtreibung wirklich bedeutet. In der Pro-Life-Bewegung gibt es daher immer mehr Mitarbeiter, die alle Hintergründe kennen und durch ihr Zeugnis die Richtigkeit der Pro-Life-Haltung bestätigen. Das ist sehr wertvoll.“
Wie hilft man Frauen, die abgetrieben haben, mit ihrer Schuld umzugehen? „Wie hilft man überhaupt denen, die in der Blindheit leben?“, ist ihre Gegenfrage. „Durch Liebe, durch Wahrheit in Liebe. Durch das Gebet, durch Barmherzigkeit. Du musst die Frauen, die abgetrieben haben, die Menschen, die in den Kliniken arbeiten, lieben, für ihre Seele beten, damit sie sich bekehren und erkennen, was sie da tun oder getan haben. Es geht um eine Botschaft der Hoffnung für sie. Nur so können wir diesen Kampf gegen die Kultur des Todes gewinnen.“
Wohin Abby kommt, stellt sie klar: „Abtreibung beutet die Frauen aus, während Mutterschaft sie stärkt. Mutter zu sein und bei den Kindern zu Hause zu sein, ist spannend, aufregend und nicht peinlich, wie uns weis gemacht wird. Wir müssen heute das Selbstbewusstsein der Mädchen stärken, die das eigentlich wollen.“
Viele tausende Frauen bezeugen heute öffentlich die Verlogenheit der Abtreibungsbefürworter und tragen dazu bei, dass viele Abtreibungskliniken in den USA geschlossen haben. Angesprochen darauf, dass hierzulande Abtreibung kaum öffentlich thematisiert wird, erklärt Abby bedauernd: „Es gibt viel zu wenig Aufklärung durch die Kirche. Viele haben Angst, jemand könnte seelisch verletzt werden, wenn man das Thema anschneidet. Also verletzen wir lieber Gott und lassen die Menschen in ihrer Blindheit.“
Zum Schluss unseres Gesprächs Frage ich sie, wie sich ihr Leben im Alltag gewandelt hat: Sie und ihr Mann haben nunmehr fünf Kinder. Ein 8-jähriges Mädchen und vier Buben: drei und zwei Jahre alt, bzw. neun und zwei Monate. Wie geht sich das aus, denke ich. Nun, der Jüngste ist adoptiert. Freunde hatten den Johnsons von einer jungen Frau erzählt, die eine Vergewaltigung hinter sich hatte und dennoch nicht abtreiben wollte. Weil sie das Kind nicht behalten konnte, war sie auf der Suche nach guten Eltern – und ist dabei bei den Johnsons gelandet. Da Abby viel reist, ist ihr Mann Hausmann geworden und kümmert sich als („a stay at home dad“ um die Kinder als Full-Time-Job.
 Getroffen haben wir uns in der Nähe von Kopfing, einem malerischen Ort in Oberösterreich. Abby Johnson, Ex-Direktorin einer Abtreibungsklinik in Texas, war eingeladen worden, über ihre Erfahrungen mit der größten Abtreibungsorganisation der USA, Planned Parenthood, sowie über ihre Bekehrung zur engagierten Lebensbefürworterin zu erzählen. Bei köstlicher Mehlspeise – Abby war seit dem Vortag kaum zum Essen gekommen – beginnt sie, mir nüchtern und sehr ehrlich, aus ihrem Leben zu erzählen.
Getroffen haben wir uns in der Nähe von Kopfing, einem malerischen Ort in Oberösterreich. Abby Johnson, Ex-Direktorin einer Abtreibungsklinik in Texas, war eingeladen worden, über ihre Erfahrungen mit der größten Abtreibungsorganisation der USA, Planned Parenthood, sowie über ihre Bekehrung zur engagierten Lebensbefürworterin zu erzählen. Bei köstlicher Mehlspeise – Abby war seit dem Vortag kaum zum Essen gekommen – beginnt sie, mir nüchtern und sehr ehrlich, aus ihrem Leben zu erzählen.