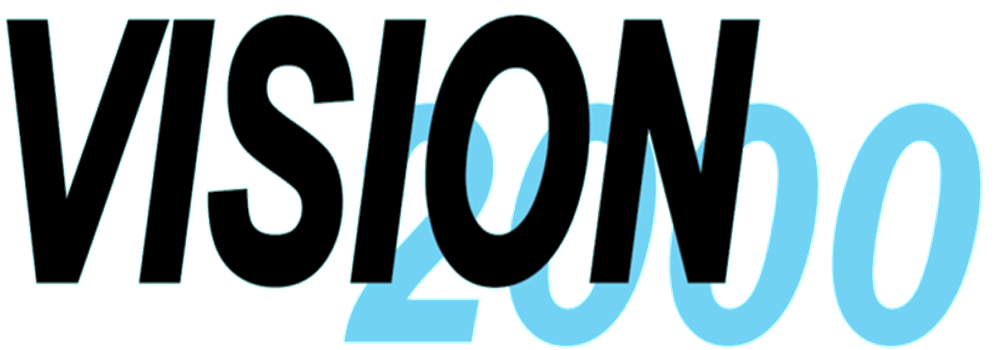Neuevangelisation, interreligiöser Dialog, Entwicklungshilfe – Begriffe, die mit Mission in Beziehung stehen. Versuch einer Klarstellung im Gespräch mit dem Nationaldirektor der „Päpstlichen Missionswerke“ in Wien.
Aus verschiedenen Gründen ist Mission selbst in der Kirche lange Zeit beinahe in Misskredit geraten. Gibt es mittlerweile eine Renaissance, was die Mission anbelangt?
P. Leo Maasburg: Ja. Auf den ersten Blick gesehen ist das Wort Mission wieder salonfähig geworden. Was hat sich in der Gesellschaft geändert, dass man wieder über Mission sprechen darf? Die Entwicklung unseres Planeten hat dazu beigetragen: Wir sind „global“ geworden. Wie viele Jugendliche sind heute schon rund um die Welt gefahren! Außerdem kann man praktisch jeden Ort der Welt ohne Zeitverzögerung per Telefon oder Internet erreichen. Eine kommunikative Allgegenwart hat sich entwickelt. Die Folge: Die Jugend beginnt, global zu denken. Weltjugendtage, Olympische Spiele, große internationale Veranstaltungen tragen dazu bei. Da kommt die ganze Welt zusammen. Und: „katholos“ heißt auf Griechisch „für alle“. Dieses Weltweite, das heute tatsächlich geschieht, entspricht dem Zugang der katholischen Kirche, die immer schon in weltweiten Kategorien gedacht hat. Sie hat ihre Mission schon immer als weltweit verstanden.
Im Zeitalter des Relativismus, des Multi-Kulti wird aber die Meinung vertreten, jeder solle auf seine Weise selig werden. Man dürfe anderen nur ja nicht seine Sichtweise aufdrängen…
Maasburg: Es wird penibel darauf geachtet, wie die christliche Botschaft verbreitet wird: dass es nur ja keinen Proselytismus, keine durch materielle Bevorzugung hervorgerufene Bekehrung gibt, keinen Kulturimperialismus. Daneben haben wir ein durchaus aggressives Werben anderer, nämlich ideologischer Kräfte, die vor allem gegenüber den Gottgläubigen wenig Toleranz kennen. Die Katholische Kirche ist in dieser Zeit keineswegs inaktiv, aber sie formulierte im Zweiten Vatikanischen Konzil klare Vorgaben: In jeder Kultur soll sich durchsetzen, was der Gottes- und Nächstenliebe am meisten dient. Ich verstehe meinen Glauben aber vor allem als Geschenk, als etwas Großartiges, das ich meinem Nächsten nicht vorenthalten will und eigentlich auch gar nicht darf, wenn ich Christi Aufruf zur unbedingten Liebe ernst nehme.
Wie sieht die Kirche also Mission heute?
Maasburg: Außer Zweifel steht, dass die Freiwilligkeit gewahrt werden muss. Weiters mahnt sie den Respekt anderen Kulturen und Religionen gegenüber ein. Im Dokument „Nostra aetate“ des Zweiten Vatikanums wird klar gesagt, dass die Kirche all das schätzen und akzeptieren muss, was in jeder Kultur und Religion gut und wahr ist. Denn alles Gute und Wahre kommt nach unserer Überzeugung immer vom selben Heiligen Geist. Das bedeutet: Ich muss zunächst auf die anderen Kulturen hinhören und in sie hineinhören. Was ist dort gut, wahr und schön? Dann geht es darum, all das mit dem katholischen Glauben zu bereichern – manches allerdings auch zu korrigieren. Durch die Verkündigung des Glaubens und seine Annahme wird die „erste Schöpfung“ Gottes in die Neuschöpfung Christi übergeführt.
Mission bedeutet, den Glauben dorthin bringen, wo er noch unbekannt ist. Heute kennen ihn aber immer weniger Europäer. Müssten da Mission nicht primär in Europa ansetzen?
Maasburg: Sicherlich. Unter Mission versteht man aber immer noch vor allem die „Missio ad gentes“, also zu den „Heidenvölkern“, zu den Menschen, die nie etwas von Christus gehört haben. Sie werden durch das Bevölkerungswachstum immer zahlreicher. Im Dienst dieser Mission stehen die „Päpstlichen Missionswerke“. Man bedenke: Es gibt 1.100 Missionsdiözesen, die vor allem von jener Unterstützung leben und wachsen, die alle Katholiken weltweit am Weltmissions-Sonntag durch Gebet und Spende geben. Das ist eine schöne Solidarität in der katholischen Familie. Allerdings sehen wir heute einen massiven Glaubensverlust in weiten Teilen Europas. Es bildet sich sogar im Schoß der Kirche ein Neuheidentum, ein säkularisiertes und im Kern gottvergessenes Denken heraus. Da besteht die Gefahr, dass man sagt: Wir haben innereuropäisch so viel zu missionieren, lassen wir das Außereuropäische sein. Dazu sei jedoch an die Worte des seligen Papstes Johannes Paul II. erinnert: Unser eigener Glaube wächst durch dessen Weitergabe. Das bedeutet: Unser Glaube hier in Europa wird nicht wachsen, wenn wir ihn nicht weitergeben – in Europa, aber auch außerhalb.
Bedarf es da neuer Methoden?
Maasburg: Kardinal Timothy Dolan, der Erzbischof von New York, hat in einer Ansprache gesagt, Neuevangelisation sei keine neue Methode. Es gehe nicht darum, Strukturen zu verändern, Missionskampagnen zu starten, cleverer oder überzeugender zu missionieren, sondern um das Bewusstsein: Alles, was ein Christ tut, muss missionarischen Charakter haben. Und wer Christus wirklich begegnet ist, Ihn wirklich liebt, bei dem hat dies Auswirkung auf die Art, wie er die Dinge tut – im Alltag, im Beruf, in der Familie. Wo das Tun des Menschen aus der Begegnung mit Christus heraus geschieht, ist es missionarisch. Auf diesem Weg wird die Erfahrung der Gegenwart Christi weitergegeben. Die Neuevangelisierung, die im Jahr des Glaubens eine besondere Rolle spielen muss, erfordert die Bekehrung von uns Missionaren. Sie wird den Glauben nicht nur in Europa erneuern, sondern weltweit die frohe Botschaft des Evangeliums erstrahlen lassen.
Wie ist das zu verstehen?
Maasburg: Dazu ein Beispiel für die Verbindung von Neuevangelisierung in der Heimat und Mission: Auf meinen Reisen für Radio Maria habe ich in Afrika Pfarren in entlegenen Gegenden besucht, in denen viele Norditaliener im Einsatz waren, Missionsstationen, die zunächst quasi der Pfarre des Heimatdorfes des Missionars nachkonstruiert waren. Später hat man erkannt, dass man bei der Bauweise, der Wasserversorgung, den künstlerischen Darstellungen nicht zu sehr europäischen Kulturexport betreiben soll. Denn vieles war ja in den Landeskulturen präsent. Das haben die Italiener gelernt. Ein Pfarrer hat mir dann erzählt, er habe Freunde, die auf Besuch kamen, animiert, vor Ort – als Tischler, Mechaniker, usw – mitzuhelfen. Während der drei Wochen ihres Aufenthaltes haben sie also etwas instand gesetzt, einen Plan angefertigt, mitgebaut. Sie lernten dabei Menschen kennen, die ihnen viel Liebe, Anerkennung und Wohlwollen entgegenbrachten. Heimgekehrt, hatten viele die Sehnsucht wiederzukommen – oft nach Antritt ihrer Pension für längere Zeit. Sie konnten sich nun besser einbringen, kosteten kaum etwas und machten ganz neue Erfahrungen. Dieses Modell hat Schule gemacht. Es entstanden Vereine, die sich der Anliegen in der Mission annahmen. Und so entstand eine neue Beziehung, die so weit ging, dass manche Italiener nach Afrika übersiedelt sind. Diese Leute haben begriffen, dass Mission Hingabe ist, nicht etwa nur ein Job, Berufung und nicht bloß Beruf. Am Ende wollten die meisten sich selbst geben.
Interreligiöser Dialog und Mission stehen in einem Spannungsverhältnis. Schließt das Eine das Andere nicht aus oder ist beides unter einen Hut zu bringen?
Maasburg: Interreligiöser Dialog hat viele Ebenen, die grundlegendste beginnt im Alltagsleben. Wenn ich in der Straßenbahn einer Frau mit Schleier gegenübersitze. Meine Gedanken, meine Haltung, meine Blicke sind bereits eine Form des Dialogs. Wir treten in Beziehung – noch bevor wir miteinander reden. Dazu ein Beispiel: Ein Monat vor meiner Priesterweihe wanderte ich eine Woche lang im Schweigen in der Wüste. Eines Tages – rund um mich nur Horizont – sehe ich weit entfernt einen kleinen schwarzen Punkt. Ein aufkommender Sturm, eine Karawane, ein Auto? Es vergeht viel Zeit und ich erkenne: Es sind Menschen – viele, wenige, Männer? Gefährlich? Harmlos? Wieder vergeht Zeit: Es sind zwei Frauen. Wie soll ich ihnen begegnen? Ich hatte viel Zeit zum Überlegen. Trotz des Schweigevorsatzes war mein Entschluss: Ich weiche nicht aus. Ein Wort von Mutter Teresa fällt mir ein: „Mission beginnt mit einem Lächeln.“ Also lächle ich – und die Frauen strahlen mich an. Wir bleiben stehen und „reden“ – ohne dieselbe Sprache zu sprechen. Zuletzt gehe ich weiter, beschenkt mit Trauben und Datteln – Folge einer reichen Kommunikation, an die ich mich heute noch erinnere. Dialog beginnt viel früher, als wir denken.
Jede Evangelisation ist immer ein Dialog. Wir teilen einander mit, was uns in der Tiefe der Herzen bewegt. Und sobald dieser Dialog aus einer missionarischen Haltung erfolgt, ist er auch schon Mission. Je näher wir Christus sind, desto näher kommen wir einander und desto näher kommen wir wiederum Christus, der Wahrheit unseres Lebens. Insofern sehe ich den Dialog sehr positiv. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir Fragen des Lebens und des Glaubens mit anderen besprechen und dabei entdecken dürfen, was Gott an Glauben im anderen grundgelegt hat. Denn wir kommen alle aus der einen Schöpfung des Vaters und haben alle denselben Auftrag, Ihn zu erkennen und zu lieben. Die Dialoge der Theologen hingegen sind sehr spezifische Gespräche ausgehend von gemeinsamen philosophischen Grundlagen
Man hört oft, Entwicklungshilfe habe längst die Mission ersetzt. Kann sie das überhaupt?
Maasburg: Ein klares Nein. Es gibt zwischen beiden aber Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten. Deshalb kann dieser falsche Eindruck entstehen. Was heißt, bei der Entwicklung zu helfen? Dazu beizutragen, dass der Mensch sich mit Leib und Seele entwickelt. Nun könnte man sagen: Die Entwicklungshilfe legt den Schwerpunkt auf die materielle Versorgung des Menschen und die Mission zielt auf dessen seelische Schulung. Weil der Mensch aber Leib und Seele ist, wirken beide eng zusammen. Sobald ich das Eine zu sehr vom Anderen trenne, wirkt sich das sogar nachteilig aus. Helfe ich dem Menschen nur materiell, ohne sein Herz, seine Seele zu bilden, kann er mit materiellem Fortschritt oft nicht mehr umgehen. Er wird ihn missbrauchen. Andererseits hat jeder Missionar immer schon gewusst, dass er nicht nur eine Kirche, sondern auch eine Schule oder ein Spital bauen muss. Denn der Mensch braucht eine seelische und eine intellektuelle Bildung. Er muss Kind Gottes werden, das auch in seiner materiellen Realität mit der Würde eines Gotteskindes leben kann.
Wo Entwicklungshilfe den Anspruch erhebt, umfassend zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen, kommt sie ohne spirituelle Hilfe nicht aus. Ohne sie kann es zu keiner dauerhaften gerechten Entwicklung kommen. Man kann auch nicht das System Demokratie exportieren, ohne dafür gesorgt zu haben, dass eine Gesellschaft heranreift, die eine Demokratie mit einem demokratischen Bewusstsein tragen kann. Als „Päpstliche Missionswerke“ bauen wir kirchliche Strukturen auf. Es sind diese Netzwerke, in denen Menschen heranreifen , mit denen dann auch andere Entwicklungshilfe-Organisationen zusammenarbeiten können. Diese Menschen, die Christus und sein Wort angenommen haben sind dann aber vor allem fähig, ihre eigenen Gesellschaften aufzubauen und ein lebenswertes Umfeld entstehen lassen, denn unverändert gilt das Wort Christi: „Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben.“ (MT 6,33).
Das Gespräch hat Christof Gaspari geführt.