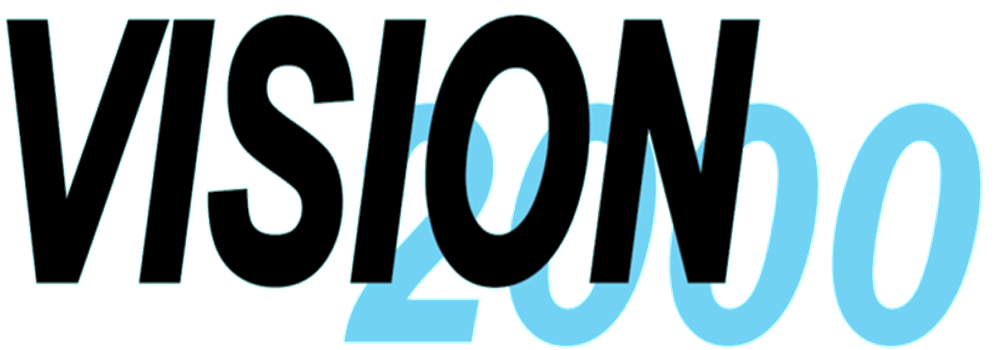Treffpunkt für das Gespräch mit Herbert Rechberger, Nationaldirektor von „Kirche in Not Österreich“, ist sein gemütliches Büro im 19. Wiener Bezirk. Nach einer Autofahrt quer durch Wien sitzt mir dort ein äußerst sympathischer, unkomplizierter, humorvoller Mann gegenüber und erzählt mir aus seinem Leben: Zur Welt kam er im steirischen Vorau, im Marienkrankenhaus, als zweites von drei Kindern. Seine Kindheit hat er in sehr schöner Erinnerung. Sein Elternhaus, so erzählt er, liegt am Ende der Straße: Auf der einen Seite der Wald, auf der anderen Seite ein Fluss. Sicher eine Idylle!
Treffpunkt für das Gespräch mit Herbert Rechberger, Nationaldirektor von „Kirche in Not Österreich“, ist sein gemütliches Büro im 19. Wiener Bezirk. Nach einer Autofahrt quer durch Wien sitzt mir dort ein äußerst sympathischer, unkomplizierter, humorvoller Mann gegenüber und erzählt mir aus seinem Leben: Zur Welt kam er im steirischen Vorau, im Marienkrankenhaus, als zweites von drei Kindern. Seine Kindheit hat er in sehr schöner Erinnerung. Sein Elternhaus, so erzählt er, liegt am Ende der Straße: Auf der einen Seite der Wald, auf der anderen Seite ein Fluss. Sicher eine Idylle!
Rechberger wächst in einem christlichen Elternhaus auf. „Die sonntägliche Messe war etwas Selbstverständliches. Und auch das Gebet war bei uns wichtig. Ich erinnere mich an heftigste Gewitter mit Stromausfall, wo das Unwetter stundenlang wie im Kreis gezogen ist, direkt über unserem Haus, so unser Eindruck. Da sind auch wir Kinder in der Nacht aufgestanden, haben uns mit der Oma und den Eltern in die Küche gesetzt, eine Kerze angezündet und Rosenkranz gebetet. So habe ich Gebet in schwierigen Stunden kennengelernt. Das hat mich geprägt.“ Dieser Glaube trägt die Familie auch durch, als der ältere Bruder tragisch mit 19 bei einem Mopedunfall ums Leben kommt. Herbert ist damals 16.
Bis zum 11. Lebensjahr lebt er in Vorau, besucht dort die Volks- und ein Jahr lang die Hauptschule. Dann soll er aber ins Gymnasium und wird 1970 mit 11 Jahren nach Unterwaltersdorf zu den Don Bosco Salesianern geschickt, fern von zu Hause ins Internat. Heimweh? Zunächst nicht, denn der kleine Herbert ist überwältigt vom Sport- und Freizeitangebot, das den Kindern hier geboten wird. Er ist ja ein begeisterter Fußballer und „zu Hause hatten wir nur auf einer ,Gstätt’n’ mit Pullover als Torstangen spielen können. Und da gab es nun eine ebene Wiese mit richtigen Toren – und mit Netz,“ erzählt er noch heute begeistert. Auch andere, für ihn neue Sportarten lernt er dort kennen.
So hat er im ersten Jahr nicht viel Heimweh. Im zweiten Schuljahr macht es sich dann aber doch stärker bemerkbar. Kein Wunder, denn nach Hause fahren kann er aus finanziellen Gründen und, weil die Zugverbindung schlecht ist (dreimal umsteigen), nur alle vier bis fünf Wochen. Allerdings betont mein Gegenüber, er habe im Gymnasium viel für’s Leben gelernt: etwa das Gemeinschaftsleben, dass man aufeinander Rücksicht nehmen muss. Ab der 4. Klasse beginnt er Gitarre zu spielen und gründet später mit Schulkollegen die Band „Helios“ (die Sonne), bei der er als Sänger und Gitarrespieler auftritt. Für den Lernerfolg sei das jedoch nicht so gut gewesen, gesteht er lachend. 1979 maturiert er.
Was er von den Salesianern für sein Glaubensleben mitgenommen habe, frage ich. „Was mir bis heute geblieben ist, ist die gesunde Marienverehrung, die ich damals aufgesogen habe. Speziell im Monat Mai. Da gab es abends im Garten eine Marienandacht und dann beteten wir im Hof auf und ab gehend Rosenkranz,“ erinnert er sich. Bei seinen Reisen für Kirche in Not konnte er diese Erfahrungen immer wieder auffrischen:
Wir überspringen viele Jahre: „Bei meiner ersten Projektreise für Kirche in Not – sie war im Mai – bin ich in den hintersten nordöstlichen Winkel Indiens gekommen. Da gibt es viele Salesianerniederlassungen. Eines Abends sagte mir der Provinzial: ,Sie werden das nicht kennen, aber wir gehen am Abend in den Garten für eine Maiandacht.’ ‚Und wie ich das kenne!’, habe ich froh geantwortet. Das war wie ein Flash: Ich bin weit weg von zu Hause, aber die machen hier das Gleiche wie damals in der Schule, die gleiche Marienverehrung. Und nach dem Abendessen und dem Gebet gab es eine kurze Gute-Nacht-Ansprache. Auch das kannte ich aus der Schulzeit. Diesmal sollte aber ich reden. Es war gewissermaßen ein Nachhausekommen.“
Nach der Matura absolviert Rechberger den Präsenzdienst beim Bundesheer und wird dann von den „Unterwaltersdorfern“ als Erzieher zurückgeholt, eine Tätigkeit, die er manchmal schon in der Oberstufe ausgeübt hatte – aushilfsweise bei den Kleinen. Er kümmert sich gern um die Kinder, macht nebenbei Kurse zur Weiterbildung. Drei Jahre bleibt er als Erzieher in der Schule. Lächelnd meint er, dass er zwar seine früheren Wunschberufe, Fußballer oder Musiker, nicht verwirklichen konnte, ihnen jedoch hobbymäßig treu geblieben sei.
In dieser Zeit lernt er auch seine spätere Frau, Evelyn, kennen. Die beiden heiraten 1982 und ziehen nach Wien. Auch da landet der junge Ehemann bei den Salesianern als Erzieher, diesmal in Unter St. Veit. Doch nach einem Jahr möchte Herbert sich verändern: „Erzieher ist ein Beruf der eigentlich keine Zeit für die eigene Familie lässt. Manchmal war ich bis 10 Uhr Abends eingesetzt.“ Ein Geographie- und Deutschstudium, das er ins Auge fasst, um den Lehrerberuf zu ergreifen, muss er aus finanziellen Überlegungen wieder fallen lassen.
P. Werenfried van Straaten, ein holländischer Priester, möchte damals die „Ostpriesterhilfe“ in Österreich neu aufstellen und sucht dafür Mitarbeiter. „Unbekümmert,“ wie mein Gegenüber lachend erzählt, „habe ich mich mit meinen 26 Jahren gleich als Geschäftsführer beworben. Ich wusste kaum etwas über die Ostpriesterhilfe oder Kirche in Not und hatte auch keine Ahnung von Bürotätigkeit.“ Also belegt er einen Büropraxiskurs für Maturanten an der Volkshochschule und beginnt 1985, zwar nicht als Geschäftsführer, aber als Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Kirche in Not.
Er bekommt Diapositive und einen Kassettenrekorder mit bespielten Kassetten, auf denen die Geschichte und Ziele von Kirche in Not aufgezeichnet sind. Damit ausgerüstet, ist es nun kein Problem bei Dekanatskonferenzen, zu denen er sich selbst einlädt, Kirche in Not vorzustellen.
Nun interessiert mich aber, wie dieses Werk entstand: Mit dem Artikel Kein Platz in der Herberge. Darin wies P. Werenfried 1947 auf das große Leid der deutschen Heimatvertriebenen hin und bat um Hilfe für sie. Er begann Geld und Lebensmittel –vor allem Speck, daher sein Ehrenname „Speckpater“ – für sie zu sammeln. Die zunächst für die Vertriebenen gesammelte Hilfe weitet sich mit der Zeit aus: auf Osteuropa für Priester und alle Christen hinter dem eisernen Vorhang, die dringend Hilfe brauchen. Es folgen Hilfsaktionen für die Kirchen in Afrika, Asien, Lateinamerika und im Nahen Osten. P. Werenfried wird zum Anwalt für Notleidende und Verfolgte.
1986 fällt der Beschluss, dass Rechberger auf Probe die Geschäftsführung von Kirche in Not Österreich übernehmen soll und, – wie ihm jetzt lachend einfällt – „genau genommen bin ich immer noch in der Probezeit, seit 34 Jahren. Eigentlich gibt es gar keinen anderen Vertrag.“ Eine spannende Anfangszeit mit vielen neuen Aufgaben: Da gibt es Pfarrarbeit, das Spendensammeln für die weltweiten Projekte und die Besuche bei Menschen, denen geholfen wird: „Das ist meine Motivation bis heute: mit dem, was wir hier tun, können wir so Vielen – jetzt etwa den Christen im Libanon oder in Syrien – ganz konkret helfen. Unsere Projektpartner sind Priester, Bischöfe, Ordensschwestern. „Zu sehen, was sie mit den Mitteln, die sie bekommen, alles bewegen können, hat mich immer wieder motiviert, etwas zu tun.“
Wie sehr hat ihn P. Werenfried selbst geprägt? „Ich habe nach 1986 beschlossen, P. Werenfried jedes Jahr nach Österreich zu einer Predigtaktion einzuladen.“ Was denn das sei, frage ich. „Wir haben z.B. ein Wochenende in Salzburg gestaltet: am Samstag zunächst ein Film im Kapitelsaal, dann am Abend und am Sonntag eine Heilige Messe mit einer Predigt von P.Werenfried. Jedes Jahr an einem anderen Ort. Begonnen habe ich mit Mariazell und das ging so bis 1998 in Lienz. Danach hatte der Pater gesundheitliche Probleme.“
Voll Hochachtung erzählt Rechberger weiter: „P. Werenfried war ein unglaublicher Typ. Er konnte auch sehr humorvoll sein. Als in Salzburg trotz ausnahmsweise schönen Wetters der Kapitelsaal randvoll war, meinte P. Werenfried zu den Zuhörern: ,Ich bin der Speckpater, der Werenfried. Normalerweise kommen bei einem Wetter wie heute zu so einer Veranstaltung entweder Heilige oder Verrückte. Ich glaube, ihr seid alle heilig.’ Dann war gleich eine gute Stimmung.“
Zu seinem 90. Geburtstag habe ihm jeder Nationaldirektor einen Hut aus seiner Heimat geschenkt. P. Werenfried habe dafür jedem eine Nachbildung seines Millionen-Huts überreicht. Mit dem Original sammelte er nämlich immer selbst nach der Predigt Spenden mit den Worten: „Dieser Hut ist sehr alt. Er hat schon Löcher. Geldstücke fallen durch.…“
Durch seine Arbeit bei Kirche in Not lernt Herbert Rechberger die Bedeutung von Weltkirche kennen. „Was es bedeutet, Christ zu sein in Syrien, in Indien oder in Nigeria, habe ich erst bei den Projektreisen in diese fernen Länder kennengelernt.“ Wie spielen sich diese Reisen ab und was ist deren Zweck, möchte ich wissen. Gern erzählt er: „Da kommen wir als gleichwertige Partner, nicht in erster Linie als Geldgeber. Unsere Partner sollen spüren, dass wir hier mit ihnen solidarisch sind, alles gemeinsam machen und für unsere Projektpartner da sind. Auch schauen wir, was bei den Projekten schon geschehen ist. Schließlich geht es auch darum: Wie können wir euch noch helfen? Was braucht ihr? Für mich kam anfangs auch noch dazu: Fotos und Reportagen machen.“
Und weiter: „Weltkirche spüren, heißt: Man geht dort in Kirchen, die unseren gar nicht ähnlich sind, manchmal nur irgendwelche Hütten. Man feiert mit ihnen eine Hl. Messe, versteht zwar die Sprache nicht, kann aber die Messe mitfeiern vom Anfang bis zum Schluss. Das ist für mich das Katholische!“ Und: „In diesen Ländern war unglaublich viel Armut, doch ich bin immer reich beschenkt heimgekommen: das miteinander Feiern, der gemeinsam gelebte Glaube, das Beisammensitzen, der Austausch.“
Die erste Reise nach Indien, seine erste außerhalb von Europa, hat Rechberger sehr geprägt: Er landet um 5 Uhr in der Früh in Bombay. Extreme Hitze, draußen bereits tausende Menschen unterwegs. Viele liegen am Boden, und man weiß nicht: Sind die tot, krank oder schlafen sie nur? „Wir sind zu einem Polizisten gegangen und haben auf einen dieser Männer gedeutet: Was ist mit dem? Der Polizist meinte: ,Wir wissen nicht, ob er tot ist. Wenn er tot ist, kein Problem. Es kommt dann eh die Müllabfuhr.’ Das war ein Schock.“ Ähnlich in Kalkutta, wo sie ein Salesianerpater abholt. „Staunen ohne Ende. Dieses Elend und die schreckliche Armut, der Lärm, die Hitze, der Dreck, die heiligen Kühe überall.“ Lächelnd fügt er hinzu: „Mein Kollege hat gemeint, er hätte bis jetzt noch nie erlebt, dass ich eine halbe Stunde nicht geredet habe.“
Er fragt sich damals, was Priester hier überhaupt tun könnten? Aber: „Ich habe dann gesehen: Die lassen sich von all dem nicht unterkriegen, gehen zu den Menschen, sind für sie da. Mit einfachsten Mitteln helfen sie. Diese Missionare überzeugen durch ihr Leben, ihr Dasein, durch die Art, wie sie Messe feiern. Das Missionarische, das ich dort erlebt habe, hat mich sehr geprägt.“ Und dann die Ordensschwestern, bei denen er eingeladen ist: „Das sind die Heiligen unserer Zeit, unheimlich starke Frauen., betreuen Waisenhäuser, Internate… Wir wurden trotz Armut bestens verköstigt, die Kinder haben gesungen und getanzt. Als es hieß, wir sollten singen, sagte ich, ich könne das nur mit Gitarre. Darauf die Schwester: ,No problem’ – und schon hatte ich eine Gitarre. So habe ich dann verschiedene Lieder gesungen. Als sie einen ‚local song’ verlangten, sang ich – als Steirer – die ‚Steirerbuam’, zum Schluss mit Jodler und die Kinder sollten mitjodeln. Das war ein Hallo!“
Welche Projekte denn unterstützt würden, interessiert mich. Vor allem pastorale: Kirchen- oder Pfarrhausneubauten, Restaurierungen von Kirchen, Bau eines Schwesternhauses, eines Priesterseminars oder eines Noviziats. Es kann aber auch um Ausbildung gehen: Priesterausbildung, Ausbildung zu Katecheten, von Laien. Wichtig ist auch die Verbreitung religiöser Literatur. „Wenn wir unsere Kinderbibel in Indien auf Hindi dort liegen sehen „Gott spricht zu seinen Kindern“ – sie wurde in 198 (!!) Sprachen übersetzt –, freut uns das sehr.“ Und schließlich noch die Motorisierung: „‘Fahrzeug für Gott’ haben wir das genannt.“
Was Motorisierung anbelangt, machte Rechberger eine tolle Erfahrung in Peru: „In Yurimaguas hat der Bischof mich und drei andere Nationaldirektoren eingeladen, das Basislager von drei Schwestern zu besuchen.“ Mit ihm und den Schwestern geht es zu einem Nebenfluss des Amazonas, wo ihnen ein kleines Schiff gezeigt wird: „Dieses Schiff, so hörte ich, hatte Kirche in Not finanziert. Welche Freude!“
Die Nationaldirektoren und der Bischof bekommen Schwimmwesten angelegt. Die Schwestern packen ihre Rosenkränze aus. Dann heißt es: Hände nicht ins Wasser stecken. Außer Piranhas schwimmen nämlich auch Krokodile im Fluss – man kann sie kaum von den Baumstämmen im Wasser unterscheiden, durch die das Boot nun mit ziemlicher Geschwindigkeit dahin gleitet. Rückblickend meint mein Gegenüber lächelnd: „Wenn ich nicht schon hätte beten können, spätestens da hätte ich es gelernt.“
Nach mehr als einer aufregenden Stunde legen sie an: Sind sie jetzt beim Basislager? Nein, heißt es, da müsse man noch ein Stück durch den Urwald gehen: bei 44 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit geht es mit Rucksack ungefähr eine dreiviertel Stunde durch den Urwald. „Dann erst sind wir im Basislager: ein Dorf im Nirgendwo, ohne Wasser und Strom.“ Kinder laufen ihnen entgegen, umarmen die Schwestern. Später sitzen sie beisammen bekommen Kokosmilch.
Wieso Basislager? „Erst von hier aus gehen die Schwestern in die verlassenen Urwalddörfer, oft Tagesmärsche entfernt, mit Rucksäcken voller Medizin und Bibeln. Für mich unglaublich! Wenn man die Schwestern angeschaut hat: Sie waren fröhlich, unbekümmert, ihr enormer Einsatz war für sie etwas Selbstverständliches.“ Erholung hatten sie nur, wenn sie für einige Tage mit dem von Kirche in Not gespendeten Schiff zurück zum Bischofshaus fahren. Dass ein „Fahrzeug für Gott“ auch so aussehen aber auch aus zwei Eseln im unwegsamen Gelände der Anden bestehen kann, hatte Rechberger vor seiner Reise nicht gewusst.
Im russischen Jakutsk hat Kirche in Not ein Salesianerhaus mitfinanziert. „Das haben wir besucht. Dort können Jugendliche, meist Straßenkinder, Zuflucht finden. Da gibt es Spielmöglichkeiten, Austausch und Ausbildungsstätten, z.B. eine Tischlerei. Die Patres versuchen Kinder von der Straße zu holen. Wir waren zur Zeit der weißen Nächte dort, wenn um Mitternacht die Sonne scheint. Auf der Straße viele Menschen, die meisten stockbetrunken. Es gibt dort ein extremes Alkoholismusproblem. Und die Kinder: unglaublich schmutzig, verwahrlost, von Moskitos überall zerstochen, verschwinden irgendwo in einem Kanaleingang. Bedrückend! Gott sei Dank gibt es dieses Haus, das einen Teil dieser Kinder auffängt und betreut. Dann weiß man wieder, dass es Sinn macht unsere Wohltäter zu bitten, uns zu helfen.“
All die Reisen, die Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen die er dabei machen konnte, haben Rechbergers Glauben gefestigt: „Wir wissen, dass es heutzutage nicht einfach ist, ein Gläubiger zu sein. Besonders in der Öffentlichkeit. Doch meine Tätigkeit hat mir sogar über manche Zweifel, was die Kirche mit ihren Skandalen betrifft, hinweg geholfen. Wir haben den riesigen Vorteil, dass wir Weltkirche erleben. Wir schauen über den Tellerrand hinaus, sehen wie viele tiefgläubige, mutige Menschen es in der Welt gibt und was sie aus dem Glauben bewirken können. Und noch etwas: Ich weiß: Da draußen gibt es Priester und Schwestern, die beten für uns. In Peru z.B waren wir mit dem Bischof bei einem kontemplativen Orden. Die Schwestern sagten uns: ,Ja, natürlich kennen wir Kirche in Not. Wir beten jeden Freitag für deren Wohltäter.’ Und eine Schwester wendet sich an mich und erklärt: ,Ich bete nur für Dich.’ Da habe ich mir gedacht: Was für ein Luxus! Gibt es ein größeres Geschenk?! Ich habe eine Schwester, die im letzten Winkel von Peru, im Amazonasgebiet, für mich betet! Immer wieder wird uns gesagt, dass für uns gebetet wird. Das berührt und stärkt uns.“
Sorge bereitet die Kirche im Mittleren und Nahen Osten. Dort leistet Kirche in Not Überlebenshilfe für die Christen vor Ort. „Es besteht die große Sorge, dass diese Ursprungsländer des Christentums einmal ohne Christen sein werden. Das versuchen wir zu verhindern. Wir helfen z.B. im Irak, die christlichen Dörfer in der Ninive Ebene, die vom Islamischen Staat fast zur Gänze zerstört wurden, wieder aufzubauen. 2012, vor dem Krieg habe ich diese Gebiet besucht. Die Christen lebten damals in Dörfern, schwer bewacht von Milizen.“
Erzbischof Sako (jetzt Patriarch von Bagdad) hatte nach Kirkuk eingeladen, in dieses wegen seines Erdölvorkommens so umkämpfte Gebiet. Die Kathedrale hatte erst kurz vor dieser Reise durch einen Anschlag großen Schaden erlitten. „Wer geht hier zur Messe, wenn es so gefährlich ist, habe ich mich gefragt. Aber die Kirche war randvoll. Die Christen dort, chaldäisch-katholisch, lassen sich nicht unterkriegen. Das gibt Kraft.“
Das Thema Christenverfolgung ist Herbert Rechberger ein besonderes Herzensanliegen: Immer wieder hält er dazu Vorträge in Pfarren und Bildungshäusern, „denn Christ zu sein, war noch nie so gefährlich wie heute.“ (Siehe Interview in Vision 1/20)
Was ihm noch wichtig wäre zu sagen, frage ich zum Schluss. Er überlegt nicht lange: „Dass unsere Spender, unsere Wohltäter wissen sollen, dass ihre Spenden bei Kirche in Not wirklich im richtigen Sinn verwendet werden. Und dass dieses Werk nicht in erster Linie dazu da ist, Geld für Projekte zu sammeln. Wir sind in erster Linie im Pastoralen angesiedelt, sehen uns aber auch als Missionswerk.“ Dann fügt Rechberger hinzu: „Ich meine: Jeder von uns hat die Aufgabe, auch als normaler Christ in Europa, Missionar zu sein, auch wenn man dafür schief angesehen wird.“ Da fällt mir ein, was Mutter Teresa uns vor 32 Jahren in Wien ins Herz gelegt hat: „Gelegen oder ungelegen sollt ihr die Wahrheit verkünden.“
Nachdem mir mein Gegenüber noch von seinen Söhnen und besonders begeistert von seinen Enkelinnen – Antonia (sechs) und Florentina (bald drei) – erzählt hat, bittet er seine Mitarbeiter zum gemeinsamen Gebet, dem ich mich anschließen darf. Ja, das Gebet ist wie das Steuer, das dem Tun den rechten Weg weist. „Wir sind auch alle aufgerufen, regelmäßig für unsere verfolgten, bedrohten und in Not geratenen Mitchristen zu beten. Hier zeigt sich eine Brücke der Liebe und Solidarität.“
Zu Mittag beten nämlich er und seine Mitarbeiter regelmäßig für die Wohltäter, besonders für jene, die an diesem Tag Geburtstag haben. Ich bin beeindruckt!
Ich verlasse Kirche in Not mit der Gewissheit, dass P. Werenfrieds Werk bei diesem mutigen Mann und seinen Mitarbeitern in den besten Händen weiterlebt.
 Treffpunkt für das Gespräch mit Herbert Rechberger, Nationaldirektor von „Kirche in Not Österreich“, ist sein gemütliches Büro im 19. Wiener Bezirk. Nach einer Autofahrt quer durch Wien sitzt mir dort ein äußerst sympathischer, unkomplizierter, humorvoller Mann gegenüber und erzählt mir aus seinem Leben: Zur Welt kam er im steirischen Vorau, im Marienkrankenhaus, als zweites von drei Kindern. Seine Kindheit hat er in sehr schöner Erinnerung. Sein Elternhaus, so erzählt er, liegt am Ende der Straße: Auf der einen Seite der Wald, auf der anderen Seite ein Fluss. Sicher eine Idylle!
Treffpunkt für das Gespräch mit Herbert Rechberger, Nationaldirektor von „Kirche in Not Österreich“, ist sein gemütliches Büro im 19. Wiener Bezirk. Nach einer Autofahrt quer durch Wien sitzt mir dort ein äußerst sympathischer, unkomplizierter, humorvoller Mann gegenüber und erzählt mir aus seinem Leben: Zur Welt kam er im steirischen Vorau, im Marienkrankenhaus, als zweites von drei Kindern. Seine Kindheit hat er in sehr schöner Erinnerung. Sein Elternhaus, so erzählt er, liegt am Ende der Straße: Auf der einen Seite der Wald, auf der anderen Seite ein Fluss. Sicher eine Idylle!